
Reallabore-Landkarte
Hier finden Sie Beispiele für Reallabore in Deutschland. Es werden sowohl abgeschlossene als auch laufende und geplante Reallabore aufgeführt.
Ein Reallabor zeichnet sich dadurch aus, dass eine Innovation (Technologie, Produkt, Dienstleistung oder Ansatz) zeitlich befristet, unter möglichst realen Bedingungen sowie oft unter behördlicher Beteiligung (z. B. genehmigt auf Basis einer Experimentierklausel) erprobt wird und dessen Erkenntnisse zum regulatorischen Lernen beitragen können.
Unter folgendem Link können Sie Ihr Reallabor für die Landkarte eintragen: Reallabor eintragen. Weitere Details, auch zu den Kriterien, was einem Reallabor im Sinne des Innovationsportals entspricht, finden Sie in den FAQ.
Übersicht Reallabore
Tech & Data Lab Frankfurt
Beim Tech & Data Lab Frankfurt geht es um die Erprobung neuer Schlüsseltechnologien – insbesondere Künstliche Intelligenz (KI), Quantencomputing und Blockchain – unter realen, aber geschützten Bedingungen. Ziel ist es, diese Technologien am Finanzplatz Frankfurt schneller, sicherer und regulatorisch abgesichert in die Praxis zu überführen. Das Lab fungiert als offene, souveräne Test- und Entwicklungsumgebung (Sandbox), in der Finanzinstitute, Start-ups, Technologiepartner, Wissenschaft und Aufsichtsbehörden gemeinsam an praxisnahen Fragestellungen (Challenges) arbeiten. Die Innovation wird dabei in kurzen, interdisziplinären Sprints entwickelt, unter Nutzung realitätsnaher Daten getestet und anschließend in Pilotprojekte oder marktfähige Lösungen überführt. Unter realen Bedingungen wird erprobt, wie sich zum Beispiel KI-Modelle vertrauenswürdig im Finanzsektor einsetzen, quantensichere Verschlüsselungen aufbauen oder Dateninfrastrukturen zwischen Banken, Start-ups und Regulierung sicher vernetzen lassen. Das Lab bietet dafür eine regulatorisch validierte Umgebung, in der Innovationen nicht im Labor, sondern unter realen Markt- und Aufsichtsbedingungen entstehen. So wird das Tech & Data Lab zum Brückenraum zwischen Technologie, Regulierung und Markt, in dem Frankfurt als europäischer Leuchtturm für vertrauenswürdige Finanztechnologie positioniert wird.
Zum Reallabor

MCube: MobiPionier - Mobilitätsbudgets und -bundles in der Metropolregion München als Alternative zu Regulierung
Das MCUBE-Projekt MobiPionier entwickelt neue, den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) ergänzende Mobilitätsangebote, im Speziellen Mobilitätsbudgets und -bundles (MBBs). Ziel ist eine empirische Untersuchung der Wirkungspotenziale dieser Angebotsformen durch Reallabore für den Alltag und Großveranstaltungen in der Metropolregion München, um den erweiterten Umweltverbund attraktiver zu machen – durch eine Verbesserung des Komforts im Ticketerwerb und eine Attraktivierung im Preis. Ein Mobilitätsbudget stellt einen festgelegten Geldbetrag für die Nutzung von Verkehrsmitteln zur Verfügung, beispielsweise 100 Euro monatlich. Ein Mobilitätsbundle kombiniert verschiedene Mobilitätsdienste, z. B. ÖPNV und Sharing-Dienste, zu einem Festpreis. Budgets und Bundles sind als Sonderform von Mobility-as-a-Service (MaaS)-Angeboten zu verstehen; die Interaktion der Nutzenden erfolgt über eine zentrale Schnittstelle, in der Regel das Smartphone. Im Projektverlauf werden die Wirkungspotenziale von Mobilitätsbudgets und -bundles, gestützt durch eine Umfrage, ermittelt und anschließend die zu testenden Produkte entwickelt. In zwei Reallaboren zu den Anwendungskontexten 'Alltagsmobilität' und 'An- und Abreise bei Großveranstaltungen' wird über einen Zeitraum von mehreren Monaten das Mobilitätsverhalten von einigen hundert Teilnehmenden mit Smartphone-Apps erhoben.
Zum Reallabor

Innovations-Gut von Thünen
Unter der Leitung des Fraunhofer IGD aus Rostock entstand mit dem Innovations-Gut von Thünen eine deutschlandweit einzigartige Forschungs- und Entwicklungsumgebung für digitale Agrartechnologien. Das Innovations-Gut von Thünen ist ein großflächiges Reallabor (> 3.300 ha arrondiertes Ackerland) zur Entwicklung, Erprobung und Validierung digitaler und automatisierter Technologien für einen nachhaltigen und effizienten Pflanzenbau. In der realen Betriebsumgebung eines landwirtschaftlichen Großbetriebs werden KI-basierte Analyseverfahren, sensorgestützte Monitoring-Systeme, autonome Maschinen sowie digitale Entscheidungswerkzeuge unter praxisnahen Bedingungen getestet und weiterentwickelt. Auf einem Teil der Fläche entwickelte Johann Heinrich von Thünen zu Beginn des 19. Jahrhunderts Musterlandwirtschaft. Diesen Geist will das Reallabor weitertragen. Ziel ist es, gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Industrie und Praxis innovative Konzepte und marktfähige Produkte zu entwickeln, die unmittelbar zur Transformation der Landwirtschaft beitragen. Die enge Zusammenarbeit der Akteure ermöglicht nicht nur einen effektiven Technologie- und Wissenstransfer, sondern schafft auch die Grundlage, um regulatorische Rahmenbedingungen aktiv mitzugestalten. Durch die systematische Vernetzung schafft das Innovations-Gut von Thünen einen Raum, in dem digitale Innovationen beschleunigt, validiert und in die landwirtschaftliche Praxis überführt werden können.
Zum Reallabor
Transformationscampus Stuttgart-Climate-Tech: Fraunhofer-Institutszentrum als nachhaltiger, resilienter und zukunftsfähiger Forschungscampus für Klima-Innovationen
Der Campus mit fünf Fraunhofer-Instituten auf einem Raum ist zugleich ein offener Experimentier- und Lernraum für nachhaltige Innovationen. Das dortige Parkhaus ist beispielsweise ein innovatives Micro Smart Grid am Standort Stuttgart und wird um eine offene und flexible FuE-Plattform erweitert, in der Innovationen entwickelt, getestet und demonstriert werden können. Neben bereits vorhandener intelligenter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und einem einheitlichen Fuhrparkmanagement werden Forschungs- und Entwicklungsmodule entwickelt, die nachhaltige und biodiverse Technologien fördern. Die Kooperation mit Industrieunternehmen führt zu neuen Innovativen Lösungen für klimaneutrale Unternehmen. Neue Potenziale werden entdeckt, Risiken werden identifiziert und Lösungskonzepte werden entwickelt. Unter anderem sind Labormodule zu urbaner Kreislaufwirtschaft, digitaler Gebäudetechnik, grüner Fassade und vertikaler Landwirtschaft geplant. Ebenfalls werden Schulungsräume und virtuelle Lernumgebungen entwickelt, durch die Nachhaltigkeitswissen vermittelt wird. Energiekonzepte werden durch Demonstrationsflächen für Photovoltaik, Wasserstoffnutzung und bidirektionale E-Mobilität integriert und ein intermodaler Mobilitätshub mit sicheren Fahrradstellplätzen und Sharing-Angeboten wird eingerichtet. Das Ziel ist ein modularer Innovationsraum für innovative Technologien, Infrastrukturen und Nutzungskonzepte im Bereich Climate Tech – mit starkem Bezug zu Energie und Mobilität.
Zum Reallabor

Green Power "TUM goes DRW" - Energieversorgung der Zukunft im Dominikus-Ringeisen-Werk
Mit dem Reallabor "TUM goes DRW" entsteht in Ursberg ein skalierbares Modell der regionalen Energie- und Rohstoffversorgung. Technologien wie dezentrale Wasserstoffproduktion, Energiespeicher, Thermolyse und KI-gestützte Systemsteuerung werden so kombiniert, dass aus Abfällen Wertschöpfung und Versorgungssicherheit entsteht. Ziel ist die Substitution von fossiler Energieproduktion mit hohem CO2-Ausstoß durch nahezu CO2-emissionsfreie Energieversorgung. Die Technische Universität München (TUM) analysiert Technologien, Stoffströme und Wirkungen und stellt eigene Entwicklungen bereit. Das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) stellt reale Bedarfe und Rahmenbedingungen: Energiebedarf, Flächen, Abfallströme, Logistik, Personal, Versorgungspflichten. Der Ansatz basiert auf drei Grundprinzipien: Reststoffe sind Rohstoffe: Aus Bioabfällen, Gülle, Klärschlamm oder Speiseresten entstehen Wärme, Strom, Gase, Biokohle, Düngerfraktionen und weitere wertvolle Produkte. Energie wird lokal erzeugt und gespeichert: Wasserstoff ersetzt Erdgas. Batteriespeicher sichern Grundlast und Netzstabilität. Die Versorgung wird planbarer. Der Effekt ist wirtschaftlich messbar: Es geht nicht um symbolische Nachhaltigkeit, sondern um tragfähige Betriebsmodelle. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet, betriebswirtschaftlich bewertet und kann damit als Grundlage für Investitionsentscheidungen dienen.
Zum Reallabor
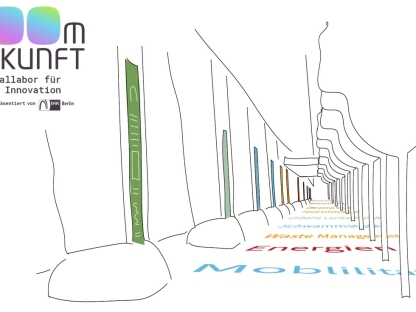
100 m Zukunft
Das Reallabor "100m Zukunft" schafft ab 2026 eine "Musterstraße", in der diese Lösungen in der Realität getestet und von relevanten Akteuren wahrgenommen und weitergedacht werden. Es wurde von der IHK Berlin gemeinsam mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf initiiert. Ziel ist es, die Stadt als klimaneutrale Metropole voranzubringen und Innovationen direkt im öffentlichen Raum unter realen Bedingungen zu erproben. Dabei sollen Lösungen entwickelt werden, die nicht nur lokal wirken, sondern auch als Modell für andere Städte dienen können. Zentral sind die Themenfelder Nachhaltige Mobilität & lokale Energieproduktion, Abfall- und Ressourcenmanagement, urbane Gesundheit sowie urbane Ernährungssysteme. Für diese Bereiche werden im Rahmen von Challenge-Prozessen Ideen gesucht, die anschließend in Prototypen umgesetzt und vor Ort getestet werden. Die Zielgruppe dieser Challenges umfasst Start-ups, etablierte Unternehmen, Vereine, zivilgesellschaftliche Organisationen sowie wissenschaftliche Einrichtungen. Ab Mitte 2026 sollen die Prototypen auf der Fasanenstraße sichtbar und erlebbar werden. Damit schafft "100 m Zukunft" einen Raum für Co-Kreation, Vernetzung und praxisnahe Experimente, die Berlins Weg zur klimaneutralen Stadt beschleunigen und gleichzeitig übertragbare Lösungen für andere Kommunen entwickeln können.
Zum Reallabor

Autopasture - Autonome Weide
Im Rahmen des Forschungsprojekts AutoPasture werden landwirtschaftliche Weideflächen in Mecklenburg-Vorpommern als Reallabore genutzt, um innovative Technologien für das automatisierte Weidemanagement unter realen Praxisbedingungen zu erproben. Zum Einsatz kommen unter anderem Virtual-Fencing-Systeme, sensorgestützte Tierüberwachung, Datenanalyseverfahren und KI-basierte Assistenzsysteme. Konkret sollen autonome Drohnenflüge zum Monitoring von Weideflächen eingesetzt werden, um mittels KI-gestützter Bildauswertung den Zustand der Weide, den Abgrasungsgrad sowie den Zustand der Pflanzen automatisiert zu erfassen und daraus ableitend zu entscheiden, wann Tiere weiterziehen müssen. Im Bereich des Virtual Fencing sollen unter anderem Halsbänder getestet werden, die die Tiere ohne physische Zäune auf den vorgesehenen Flächen halten. Ziel ist es, nachhaltige, tiergerechte und wirtschaftlich tragfähige Lösungen für die Weidewirtschaft der Zukunft zu entwickeln. Die Reallabore ermöglichen durch eine enge Einbindung von Landwirtinnen und Landwirten, Wissenschaft und Technologieträgern praxisnahe Experimente, die rechtlich bislang nur eingeschränkt möglich sind. Durch eine angestrebte Anwendung der Experimentierklausel sollen regulatorische Hürden identifiziert und rechtssicher erprobt werden.
Zum Reallabor
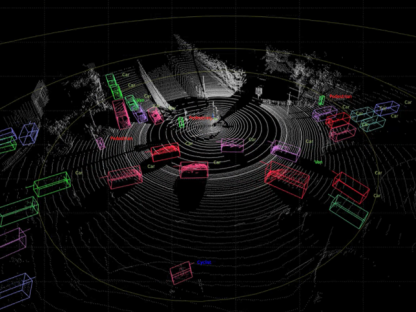
Reallabor Mobilität
Mithilfe innovativer Sensorik erfassen Forschende der Technischen Hochschule Aschaffenburg in Kooperation mit der Stadt Aschaffenburg den Verkehr auf dem gesamten Stadtringnetz in Echtzeit und schaffen die Grundlage für intelligente Mobilitätslösungen. Das Forschungsprojekt "Reallabor Mobilität" verfolgt das Ziel, den Verkehr auf dem Aschaffenburger Cityring mithilfe vernetzter, datenschutzkonformer Multi-Sensorsysteme zu erfassen, Unfallursachen zu analysieren und den Verkehrsfluss nachhaltig zu optimieren. Die zugrunde liegende Infrastruktur basiert auf zwölf vernetzten LiDAR-Systemen und ermöglicht eine vollständige, hochpräzise Erfassung aller Hauptverkehrsknoten im definierten Bereich – als geschlossener Kreislauf ("Closed Loop"). Auf dieser Datengrundlage können neue Maßnahmen zur Verkehrsoptimierung sowie zur Verbesserung der Ökobilanz entwickelt werden. Durch den Einsatz KI-gestützter Methoden gewinnen die Analysen sowohl wissenschaftliche als auch wirtschaftliche Relevanz. So wird Aschaffenburg als Modellstadt für die Mobilitätsforschung etabliert. Die Methoden zur Datenerfassung, die zu entwickelnden Technologien sowie die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung der Verkehrsplanung und Verkehrssicherheit sind auf viele mittelgroße Städte in Europa übertragbar.
Zum Reallabor

CIRI HUB @ Circular Interiors Alliance
Die Circular Interiors Alliance (CIRI) ist ein offenes Ökosystem zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Immobilienbranche mit Fokus auf den Innenraum (Boden, Wand, Decke und Einrichtung). Das Projekt verbindet Ausstellung, Reallabor, Bildung und Austauschplattformen, um Nachhaltigkeit praxisnah erlebbar zu machen. Es sollen möglichst viele Prozessbeteiligte wie Architektinnen und Architekten, Projektentwicklerinnen und -entwickler sowie Managerinnen und Manager in öffentlichen und privatwirtschaftlichen Unternehmen zusammenfinden, sich austauschen und unter anderem Potentiale für eine Reduzierung des CO2-Verbrauchs erarbeiten. Das mobile Hub wird als Roadshow umgesetzt und soll als Labor, Bühne und Begegnungsort dienen. Es ist offen für Akteure aus Wirtschaft, Kommune und Zivilgesellschaft. In Form von Feedbackrunden und Ausstellungsformaten werden kontinuierlich neue Anregungen gesammelt und die Arbeit am tatsächlichen Bedarf des Marktes nachjustiert. Zudem wird die Entwicklung konkreter Verfahren und Produkte wie beispielsweise ein multifunktionales Akustikmodul unterstützt. Dabei werden Lösungen aus dem Netzwerk wie zum Beispiel KI-Anwendungen zwischen den Partnerunternehmen in Kooperation verwendet und weiterentwickelt. Das Projekt schafft eine langfristige tragfähige Struktur und trägt zur Umsetzung von Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) bei.
Zum Reallabor

TUM Mobility Innovation Campus
Autonomes Fahren ist eines der großen Zukunftsthemen mit dem Potenzial, das Mobilitätssystem disruptiv zu verändern. Die gesellschaftliche Akzeptanz hängt dabei entscheidend von der Sicherheit in technischer und rechtlicher Hinsicht sowie von den gesamtverkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrseffizienz ab. Der Mobility Innovation Campus (MIC) leistet einen Beitrag zur Prüfung, Entwicklung und letztlich zur Gewährleistung der Sicherheit von Mobilitätskonzepten mit autonomen Fahrzeugen. Der Fokus der hier geplanten Versuche liegt auf der Interaktion mit sogenannten Vulnerable Road Users (VRU) wie Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern, Fußgängerinnen und Fußgängern sowie auf der Erprobung des berührungslosen (induktiven) Ladens von Elektrofahrzeugen. Weiterhin werden gesamtverkehrliche Auswirkungen von autonomen Verkehrskonzepten auf das Verkehrssystem untersucht.
Zum Reallabor
KI-Datenplattform
Die KI-Datenplattform der KI-Allianz Baden-Württemberg erleichtert Unternehmen, Start-ups und öffentlichen Institutionen die Bereitstellung und den Zugang zu KI-Modellen und dazu passenden qualitätsgesicherten Datensätzen und fördert dadurch die Entwicklung innovativer KI-Anwendungen. Die KI-Datenplattform unterstützt folgende Ziele: Open-Source: Konzeption, Implementierung und Bereitstellung einer betriebstauglichen, anpassbaren Plattform Compliance by Design: Vereinbarkeit mit ethischen Prinzipien und rechtlichen Rahmenbedingungen HPC-Ressourcen: erleichterter Zugang zu Rechenressourcen zur Ausführung von KI-Modellen. Werkzeuge + Services: Automatisierte Datenqualitätsservices prüfen und optimieren hochgeladene Datensätze für die KI-Nutzung. Zudem verschafft die KI-Datenplattform den Zugang zu sektorspezifischen Datenräumen, um den standardisierten, sicheren und souveränen Austausch von Daten innerhalb einer Branche zu ermöglichen – etwa in der Produktion, der Mobilität, im Gesundheitswesen oder bei Smart Cities. Durch gemeinsame Regeln, Schnittstellen und Metadatenstandards schaffen sie Vertrauen, fördern Interoperabilität und erleichtern die Entwicklung sowie den Einsatz von KI-Anwendungen. Die KI-Datenplattform ermöglicht den niederschwelligen Zugang zu KI-Assets (Daten und KI-Modellen) und etabliert so einen Markt für KI-Assets.
Zum Reallabor
5GCampus-KIShuttle
Ziel des Projektes 5GCampusKIShuttle ist es, mit Hilfe von 5G- und KI-Technologie autonome Fahrzeuge so sicher und wirtschaftlich zu ermöglichen, dass die Akzeptanz und Verbreitung sowohl bei Betreiber wie auch bei Kunden von Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen spürbar und nachhaltig erhöht wird. Im Rahmen dieses Reallabors wird daher die infrastrukturseitige Voraussetzung für einen autonomen Fahrbetrieb geschaffen. Wesentlicher Bestandteil des Projektes ist die Ausstattung einer Referenzstrecke am Campus Wolfenbüttel mit Infrastrukturkomponenten für die Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation (V2I) mit sogenannten Road-Side-Units (RSU). Diese RSUs dienen einerseits der Bereitstellung von Daten und Verkehrsinformationen, andererseits auch der Bereitstellung von Informationen für weitere Verkehrsteilnehmer (z. B. Fußgänger, Radfahrer und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel) über etablierte Funkschnittstellen. Des Weiteren werden die RSUs Daten von angeschlossenen Sensoren der Infrastruktur erfassen (z. B. von Kameras, Laserscanner, Radar,- oder LiDAR-Sensoren).
Zum Reallabor
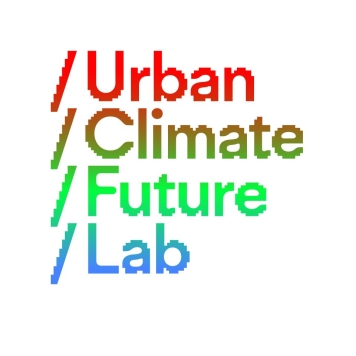
Urban Climate Future Lab
Das Urban Climate Future Lab (UCFL) ist ein interdisziplinäres Reallabor, das die Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Urbanisierung untersuchen wird. Ziel ist die Entwicklung wissenschaftlich fundierter, praxisnaher Lösungen zur nachhaltigen Transformation urbaner und ländlicher Räume – mit besonderem Fokus auf Niedersachsen. Das Reallabor wird zunächst in Salzgitter aufgebaut, zwei weitere Standorte werden im Herbst 2025 ausgewählt. Die zentrale Innovation liegt in der integrativen Erforschung von Stadtklima, Ressourcenmanagement und urbaner Resilienz unter realen Bedingungen. Dabei sollen verschiedene urbane Typologien – von Städten über Industriegebiete bis hin zu Quartieren – analysiert werden, um maßgeschneiderte Klimaschutz- und Anpassungsstrategien zu entwickeln. Durch die enge Zusammenarbeit mit Forschung, Industrie, Zivilgesellschaft und Politik werden neue Lösungsansätze direkt in der Praxis getestet und weiterentwickelt.
Zum Reallabor

Medifly Hamburg (Phase 2+3)
Medifly Hamburg befasst sich mit dem Transport medizinischer Güter mittels Drohnen über besiedeltem Gebiet und innerhalb von Kontrollzonen internationaler Flughäfen. In einer Testphase sollen regelmäßige Drohnenflüge zwischen mehreren Krankenhäusern in Hamburg stattfinden, bei denen medizinische Güter wie Medikamente, Labor- und Gewebeproben transportiert werden. Die Flugrouten von Medifly erstrecken sich in der Nord-Süd-Ausrichtung von Langenhorn bis Harburg und in der West-Ost-Ausrichtung von Rissen bis Barmbek-Süd. Die Medifly-Drohne bekommt vorab ihre Flugstrecke übermittelt und fliegt diese automatisiert ab. Der Flug wird dabei durchgehend von einer Fernpilotin oder einem Fernpiloten überwacht, die im Notfall in die Steuerung eingreifen können. Die Durchführung von Drohnenflügen außerhalb der Sicht der Fernpilotinnen und -piloten in einer Kontrollzone ist rechtlich, insbesondere aus Sicht der Flugsicherungen, noch nicht abschließend geregelt. Daher müssen Flugsicherungen und Drohnenbetreiber derzeit für jeden Betrieb zunächst Verfahren festlegen, die dann von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden müssen. Allerdings fehlt es derzeit an rechtlichen Vorgaben. Neben der Integration des neuen Verkehrsträgers in den Luftraum steht auch die Integration in die Krankenhausprozesse im Fokus des Projekts.
Zum Reallabor
Reallabor für Intelligente Mobilität
Im Reallabor für Intelligente Mobilität wird die Zukunft des urbanen Verkehrs praktisch erprobt: Im Zentrum steht der Einsatz autonom fahrender Shuttlebusse und Lieferfahrzeuge im öffentlichen Raum. Ziel ist es, neue Formen des automatisierten Fahrens unter realen Bedingungen zu testen und weiterzuentwickeln – technisch, sozial und organisatorisch. Dazu wird ein 5G-Testfeld genutzt, das die Kommunikation in Echtzeit zwischen Fahrzeugen, Sensoren in der Umgebung und einer zentralen Leitstelle ermöglicht. Sensoren im Fahrzeug und in der Infrastruktur erfassen kontinuierlich Verkehrslage, Umweltbedingungen und die Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmenden. Die Fahrzeuge sollen nahezu vollständig autonom (Level 4) operieren und werden im Hintergrund von einer Betriebsleitstelle überwacht, die bei Bedarf eingreift. Das Reallabor liefert wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung sicherer, ressourcenschonender und flexibler Mobilitätslösungen. Besonders im Fokus stehen dabei die Anbindung der "letzten Meile", die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs sowie neue Dienstleistungsformen wie On-Demand-Angebote und automatisierter Warentransport. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung, Forschung und Wirtschaft werden Technologien nicht nur getestet, sondern als erfahrbare Innovation in den Alltag eingebunden. So wird der Wissenschaftshafen zur Modellregion für intelligentes, vernetztes und sozial akzeptiertes autonomes Fahren – mit bundesweiter Strahlkraft.
Zum Reallabor

Schuppi autonom (Erprobung der autonomen Fähre "Schuppi")
Im Reallabor "Schuppi" wird die autonome Navigation und Objekterkennung für eine emissionsfreie Personenfähre unter realen Bedingungen erprobt. Ziel ist die Entwicklung eines sicheren, autonom fahrenden Wasserfahrzeugs für den urbanen Raum – insbesondere für den Einsatz im Fischereihafen I in Bremerhaven. Dazu wurde ein Demonstrator gebaut, ausgestattet mit einem modularen Autonomiesystem, das Sensorik wie LIDAR, Stereokamera, GPS, IMU und AIS kombiniert. Damit werden Objekte wie Schiffe, Personen oder Spundwände erkannt, um Kollisionen zu vermeiden. Die Steuerung erfolgt über die Open-Source-Software ArduPilot (ArduRover), die autonomes Fahren entlang definierter Wegpunkte ermöglicht. Die zentrale Innovation liegt in der Integration kostengünstiger, marktverfügbarer Komponenten in ein anpassbares System für den maritimen Einsatz. Erprobt wird das System in einer realen, aber regulierungsarmen Umgebung – zunächst auf nicht öffentlichen Gewässern, anschließend im Fischereihafen. Da es kaum genehmigungsfähige Testumgebungen für autonome Schiffe in Deutschland gibt, bietet das Reallabor Schuppi – ermöglicht durch das Land Bremen, das Hafenamt und bremenports – Gelegenheit, Funktionalitäten zu testen, Daten zu generieren und Grundlagen für eine künftige Regulierung zu schaffen.
Zum Reallabor

B(e)Ware
Im Rahmen des Berliner Pilotprojekts "Förderung wirtschaftsorientierter Reallabore" der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe entwickelt das Reallabor B(e)Ware des Natural Building Lab der TU Berlin in Zusammenarbeit mit ZRS Architekten die erforderlichen Werkzeuge, Infrastruktur und Netzwerke für die Herstellung von tragenden Gebäudetragwerken aus Berliner Bau- und Rückbaustellen. Ziel der Förderung ist es, Ideen aus Forschung und Entwicklung noch schneller und zielgerichteter zur Marktreife zu bringen, sodass sie unter echten Bedingungen erprobt werden können. Im Reallabor B(e) Ware werden Berliner Gebrauchtstoffe (B Ware) zur wertvollen Ressource (A Ware) für den Bausektor und dafür ein einmaliges Konzept zur vereinfachten Realisierung von anspruchsvollen Gebäudetragwerken aus lokalen Gebrauchtstoffen entwickelt – hier ist alles (Innovation, Material und Gebrauchtstoff) "Made in Berlin". Ziel ist es, aus der Grundlagenforschung zusammen mit Partnern aus der Praxis in die Anwendung zu kommen, um daraus konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten – beispielsweise für regulatorische Anpassungen im Bauwesen. Als transformativer Inkubator schließt das Vorhaben organisatorische, rechtliche, kapazitäre, finanzielle und zeitliche Lücken in klassischen Bauvorhaben und schafft fehlende Schnittstellen zwischen der Bauforschung und Planungspraxis zur kreislaufgerechten Organisation von Wertschöpfungsketten in Berlin, Deutschland und Europa.
Zum Reallabor
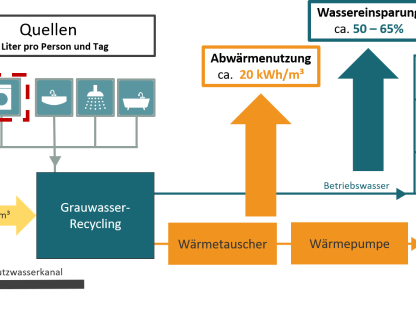
Integrierte Wasser- und Wärmerückgewinnung im Quartier (IWIQ)
Im Reallabor IWIQ ("Integrierte Wasser- und Wärmerückgewinnung im Quartier") wird erstmals unter realen Bedingungen erprobt, wie Grauwasserrecycling (GWR) und Wärmerückgewinnung (WRG) in Bestandsgebäuden umgesetzt und skaliert werden können. Die technologische Innovation liegt in der Aufbereitung von leicht verschmutztem Grauwasser (aus Bad, Küche und Waschmaschine) zu hochwertigem Betriebswasser, das unter anderem für Toilettenspülung, Waschmaschinen oder Bewässerung genutzt werden kann. Damit lassen sich bis zu 60 % des Trinkwasserverbrauchs einsparen. Parallel wird die im Grauwasser enthaltene Wärme über Wärmetauscher und Wärmepumpen zurückgewonnen, wodurch bis zu 60 % des Energiebedarfs für Warmwasser gedeckt und perspektivisch auch Nahwärmenetze gespeist werden können. Neuartig ist die Integration dieser Systemlösung in die Sanierung von Bestandsgebäuden – unter Einsatz von Building Information Modeling (BIM) und neuen Verlegekonzepten für ein zweites Leitungsnetz. Ergänzt wird dies durch datengetriebene Betriebsoptimierung und Verfahrenserweiterung der Aufbereitung sowie einen hybriden Lernort, der die Beteiligung von Wohnungsunternehmen, Behörden, Handwerk und Öffentlichkeit sicherstellt und so die Übertragung in andere Quartiere ermöglicht.
Zum Reallabor
Future Food Living Lab
Mit dem Future Food Living Lab soll ein Reallabor aufgebaut werden, das einen Beitrag zur gesellschaftlichen und technologischen Transformation hin zu einer nachhaltigeren und gesünderen Ernährung leistet. Es versteht sich als Experimentierraum für gemeinsames Gestalten, Lernen und Evaluieren, um etablierte Strukturen aufzubrechen und Forschende, Bürgerinnen und Bürger, Studierende, lokale Initiativen und Praxisakteurinnen und Praxisakteure sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Interaktion zu bringen. Im Reallabor werden fünf Aktionsfelder bearbeitet: Urban Production: Die Technik der urbanen Lebensmittelproduktion wird unter realen Bedingungen in einem städtischen Umfeld getestet. Alternative Organismen: Wie können die Organismen produziert und weiterverarbeitet werden? Gesellschaftliche Transformation: Agrifood-Innovationen werden nahe zur Bürgerin und zum Bürger gebracht und es wird Partizipation und Co-Development mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen auf verschiedenen Ebenen ermöglicht. Transformation der Agrifood-Systeme: Nachhaltige und resiliente Gestaltung von Agrifood-Systemen mit gesunder Ernährung bedarf weiterer Forschung, Entwicklung und vor allem passgenauer Innovationen. Transfer: Themenübergreifend sollen Veranstaltungsformate angeboten werden, in denen KMUs und Start-ups Zugang zu Infrastruktur und zu anderen Akteurinnen und Akteuren erhalten, um z. B. in Challenges gemeinsam neue Ideen und Business-Konzepte zu entwickeln.
Zum Reallabor

Smart.Bodo
Ziel ist es, in zwei landwirtschaftlichen Betrieben Reallabore für die strukturierte Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis bei der Sanierung und Wiederherstellung landwirtschaftlicher Bodenwerte einzurichten. Dabei soll es gelingen, die fünf Kriterien der Transformationsforschung umzusetzen. Ein Schwerpunkt liegt auf Lernprozessen und Reflexivität. Dabei soll ein Fünf-Punkte-Plan zur Wiederherstellung zerstörter landwirtschaftlicher Böden in Vordergrund stehen. Dieser ist Grundlage für Sanierungs- und Zertifizierungsprozesse, die digital unterstützt werden. Durch digitale und mediale Tools soll die Qualifizierung von schnellen Einsatzteams nach Naturkatastrophen oder Havarien organisiert und fachgerechte Maßnahmen beschleunigt werden. Dabei gilt es, die Kriterien zur Qualifizierung festzulegen, mit fachkompetenten Teams innerhalb der Reallabore einzuüben und Einsatzpläne für Sachstands- und Schadensaufnahme, Bodensanierungen und Zertifizierung des Sanierungserfolges zu erstellen. Hierzu gehören auch Kurse zur Nutzung von vorhandenen und in der Entwicklung befindlichen Geoinformationssystemen sowie innovativen Systemen der Datenerfassung, wie Drohnen und andere technische Lösungen. Darüber hinaus soll die Personenzertifizierung in ein studien- und berufsbegleitendes Aus- und Weiterbildungsprogramm für in unterschiedlichen Bereichen der Agrarwirtschaft Tätige integriert werden.
Zum Reallabor
KI-Reallabor Gesundheit BW
Das KI-Reallabor Gesundheit Baden-Württemberg (KI-Reallabor Gesundheit BW) wird vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg gefördert und wurde vom Bosch Digital Innovation Hub als geschützter Experimentierraum zur effektiveren Implementierung von digitalen und KI-Innovationen im Gesundheitswesen initiiert. Innerhalb des KI-Reallabors Gesundheit BW werden KI-Innovationen über drei Aktivitätslinien hinweg begleitet und betreut: Über das KI-Daten Lab als Berater für trusted health data; Über das KI-Framework Lab als Interaktionsfläche mit regulatorischen Behörden für gestaltenden Datenschutz und regulatorisches Lernen; Über das KI-Kompetenz Lab zur besseren Akzeptanz und Nutzungsverhalten von KI-Innovationen im Gesundheitswesen. Dadurch sollen KI-Innovationen befähigt werden, einfacher und schneller in den Gesundheitsmarkt zu gelangen und dadurch eine höhere Anwendungsquote für digitale KI-Innovationen erzielt werden.
Zum Reallabor
KI-Reallabor Agrar
Das KI-Reallabor Agrar (RLA) in Niedersachsen erprobt KI- und Robotik-Technologien in der Agrarwirtschaft unter realen Bedingungen. Das Hauptziel ist die Transformation der Landwirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit durch die Erforschung, Entwicklung und Erprobung von KI- und Robotik-Technologien, Data Science-Methoden und Agrardatenräumen. Darüber hinaus ist die Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens für den Einsatz von KI- und Robotik in der Landwirtschaft eines der Kernziele. Im RLA wird ein umsetzungsorientierter co-kreativer Prozess verfolgt. Weitere Ziele sind die Qualifikation landwirtschaftlicher Akteure und die Akzeptanzsteigerung von KI und Agrarrobotik. In den Use Case-Projekten Biodiversitätsmonitoring, Teilautonome Landtechnik und Neue Agrarprozesse sollen die KI- und Robotik-Basiselemente erste Wirkungen entfalten. Das RLA wird bei den beteiligten Institutionen und auf einem agrartechnischen Versuchshof im Landkreis Osnabrück durchgeführt. Das sogenannte FieldLab dient als zentrale Forschungs- und Innovationsplattform. Das Projekt wird von einem interdisziplinären Konsortium bestehend aus dem Konsortialführer Universität Osnabrück, dem DFKI Niedersachsen (FB Planbasierte Robotersteuerung), der Hochschule Osnabrück, dem Agrotech Valley Forum e.V., der Technischen Universität Braunschweig, dem Johann Heinrich von Thünen-Institut, dem Netzwerk Ackerbau Niedersachsen e.V. sowie dem Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. getragen.
Zum Reallabor

Testraum des Zukunftskonzepts Innenstadt
Der "Testraum" in Offenbach am Main ist ein Teil des strategisch angelegten "Zukunftskonzepts Innenstadt" und Schaufenster für neue Ideen und Experimentierfeld für die Innenstadt von morgen. Unternehmerinnen und Unternehmer, Start-ups sowie Gründerinnen und Gründer mit innovativen Konzepten können hier für bis zu drei Monate kostenfrei ihr Geschäft ausprobieren – mitten in der Innenstadt. So wird unter realen Bedingungen getestet, ob Produkte, Services oder Handelsmodelle in Offenbach funktionieren, wie Kundschaft reagiert und welche Konzepte dauerhaft tragfähig sind. Die Innovation liegt nicht allein in der mietfreien Nutzung, sondern in der umfassenden Unterstützung durch den Projektzusammenschluss der Stadt Offenbach mit dem Verein Offenbach offensiv: von professioneller PR- und Social-Media-Begleitung über Beratung bis hin zur Komplettausstattung des Ladengeschäfts. Mit dem Testraum senkt die Stadt die Einstiegshürden für Gründerinnen und Gründer erheblich: Eine fertig eingerichtete Fläche mit Schaufensterfront, zentrale Lage und ein klarer zeitlicher Rahmen ermöglichen ein nahezu risikofreies Ausprobieren. Ziel ist es, Leerstände zu beleben, neue Impulse in die Innenstadt zu bringen und langfristig attraktive Geschäfte für Offenbach zu gewinnen. Der Testraum ist ein zentraler Baustein der "Testraum-Allee" im Rahmen des Zukunftskonzepts Innenstadt – ein Projekt, das zeigt, wie urbane Innovation konkret erlebbar wird.
Zum Reallabor

Reallabor ZEKIWA Zeitz
Das Reallabor ZEKIWA Zeitz revitalisiert das Areal der ehemaligen Kinderwagenfabrik als Modellprojekt für ästhetisch vorbildliches, nachhaltiges und zirkuläres Bauen nach den Kriterien des Neuen Europäischen Bauhauses: beautiful, sustainable, together. Das multidisziplinäre ZEKIWA-Konsortium, bestehend aus der Hochschule Anhalt, der Stiftung Bauhaus Dessau, der Burg Giebichenstein, der Martin-Luther-Universität, dem Forum Rathenau und der Stadt Zeitz, verknüpft Bauen und Gestalten in einem gesamtgesellschaftlichen Prozess. Dabei entsteht ein Vorzeigebeispiel für lebendige, inklusive und klimagerechte Stadterneuerung sowie für gelungene gemeinschaftsorientierte Revitalisierung eines Industriedenkmals.
Zum Reallabor
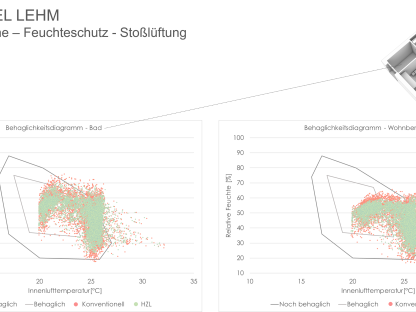
HZL - Gesundes, zukunftsfähiges Wohnen in Holz, Ziegel und Lehm
Das Projekt HZL – Gesundes, zukunftsfähiges Wohnen in Holz, Ziegel und Lehm untersucht In Zusammenarbeit von TU Berlin, TU Braunschweig, Universität Stuttgart, Stadt und Land Berlin sowie ZRS Architekten und Bruno Fioretti Marquezin einem inter- und transdisziplinären Reallabor, wie klimafreundlicher Mietwohnungsbau mit Naturbaustoffen gelingt. In Berlin-Britz entstehen zwei kompakte Baukörper in Holz-Lehm- und Ziegel-Holz-Bauweise, die konsequent auf ressourcenschonendes LowTech setzen. Anstelle komplexer Klima- und Lüftungsanlagen übernehmen hygrothermisch aktive Materialien wie Holz, Lehm und Naturfasern die Regulierung von Temperatur und Luftfeuchte. Damit wird ein gesundes Raumklima zwischen 40 und 60 % relativer Feuchte bei freier Lüftung erreicht. Konkret wird im Projekt die Frage untersucht, inwieweit durch Materialwahl und bauliche Konzeption eine nutzerunabhängige Lüftung, wie sie in normativen Regelwerken (etwa DIN 1946-6) gefordert ist, durch alternative Strategien ersetzt oder zumindest teilweise kompensiert werden kann. Ein detailliertes Monitoring erfasst bauphysikalische Prozesse, Komfortparameter und ökologische Kennzahlen über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Die gewonnenen Daten fließen in Simulationen, Lebenszyklusanalysen und den Vergleich der Bauweisen ein. So entsteht eine belastbare Grundlage, um technikreduziertes Bauen im öffentlichen Wohnungsbau zu bewerten und weiterzuentwickeln.
Zum Reallabor

KIRR Real - Reallabor für rechtskonforme KI und Robotik
Mit dem seit 2024 geltenden AI Act und der 2027 in Kraft tretenden neuen Maschinenverordnung, die Anforderungen an KI als Bestandteil von Maschinen enthält, stehen Unternehmen vor großen Herausforderungen, den Einsatz von KI rechtskonform zu gestalten. Angesichts der komplexen Regelungen bestehen Unsicherheiten insbesondere bei Start-ups und KMU. Dies betrifft den KI- und Industriestandort Baden-Württemberg in besonderem Maße, beispielsweise in Schlüsselbranchen wie der Prozess- und Fertigungstechnologie, die von großer Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der baden-württembergischen Wirtschaft insgesamt sind. Damit die baden-württembergische Wirtschaft beim Einsatz der Schlüsseltechnologie KI nicht durch die neue EU KI-Regulierung zurückgeworfen wird, hat das Projekt KIRR Real das Ziel, ein Reallabor zu KI, Robotik und Recht zu etablieren, um Unternehmen in Baden-Württemberg bei der Umsetzung des AI Acts und der Maschinenverordnung zu unterstützen. Dabei sollen insbesondere Präzedenzfälle zur Einschätzung der Risikoklasse gemäß AI Act und zur Prüfung von KI-Systemen nach den Vorgaben der Maschinenrichtlinie und des AI Acts geschaffen werden.
Zum Reallabor

Die Datenschutz-Sandbox
Der Landesbeauftrage für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI RLP) richtet in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl von Prof. Dr. Christoph Krönke, Öffentliches Recht I, und dem Lehrstuhl von Prof. Dr. Agnes Koschmider, Wirtschaftsinformatik, jeweils Universität Bayreuth, die Datenschutz-Sandbox ein. In dieser können Unternehmen und Behörden Fragen zur Datenschutzkonformität ihrer Anwendungen vor Einführung im Realbetrieb in Austausch mit dem LfDI RLP behandeln. Mögliche Datenschutzprobleme sollen so in einem gesicherten Rahmen niedrigschwellig erkannt und adressiert werden. Die Datenschutz-Sandbox soll dadurch Unternehmen und Behörden, die innovative, aber datenschutzrechtlich herausfordernde digitale Anwendungen einsetzen möchten, dabei unterstützen, Unsicherheiten abzubauen. Das vom BMFTR geförderte Projekt analysiert zudem, welche rechtlichen und informationstechnischen Bedingungen für Sandbox-Verfahren insbesondere im Datenschutzrecht gelten, und bereitet praxisnahe Handlungsempfehlungen für andere Behörden auf.
Zum Reallabor

Offshore Drone Campus Cuxhaven (ODCC)
Als enge Kooperation zwischen der Fraunhofer-Gesellschaft, wissenschaftlichen Partnern und der Industrie wird am Offshore Drone Campus Cuxhaven (ODCC) die gemeinschaftliche Entwicklung und Erforschung von Drohnen und deren Einsatzkonzepten für die Verwendung im Offshore-Bereich durchgeführt. Hierbei liegt der Fokus des Fraunhofer IFAM auf Fragestellungen der Wartung und Inspektion sowie Instandhaltung und Überwachung wichtiger maritimer Strukturen. Ziele sind das Erreichen einer Kostensenkung durch autonome Langzeit-Inspektionen von z. B. Offshore-Windenergieanlagen sowie die Steigerung der Nachhaltigkeit der Energieerzeugung durch den Einsatz elektrisch angetriebener Fluggeräte. Das Fraunhofer IFAM arbeitet am ODCC in Cuxhaven an folgenden Schwerpunkten: Systemkonfiguration von UAS Missionsabhängige Konfiguration des UAS-Systems zur Abdeckung individueller Bedarfe Untersuchung der Möglichkeiten der Energieversorgung durch Gegenüberstellung von Batteriesystemen, Verbrennungsmotoren (Treibstoffhybrid-Antrieb) und Brennstoffzellen (Wasserstoffhybrid-Antrieb) Komponentenentwicklung Entwicklung fehlertoleranter Antriebssysteme zum sicheren Manövrieren der Drohnen Entwicklung von Materialschutzkonzepten für den Offshore Einsatz Erforschung von Endeffektoren und Sensorsystemen Flugbetrieb und Flugsicherung Kontinuierliche Flugüberwachung für eine sichere Integration von bemannter und unbemannter Luftfahrt
Zum Reallabor
CRAI Center of Research and Development of Trustworthy AI Applications for Mid-Sized Companies / Reallabor für vertrauenswürdige KI im Mittelstand
CRAI ist ein KI-Reallabor, das mittelständische Unternehmen bei der Entwicklung und Anwendung von vertrauenswürdigen KI-basierten Geschäftsmodellen begleitet. Es ermöglicht Unternehmen, trotz Mangels an technischem Know-how, begrenzter Ressourcen und rechtlicher Unsicherheiten, KI-Systeme zu implementieren. Besonderheit des Labors ist die ganzheitliche Begleitung des Mittelstandes bei der Entwicklung vertrauenswürdiger KI-Systeme: KI-Systeme werden über den Entwicklungszyklus hinweg getestet und weiterentwickelt mit dem Fokus "compliance by design". Zugleich wird ein Austausch der Erkenntnisse aus den Entwicklungs- und Begleitprozessen an regulierende Instanzen gewährleistet und umgekehrt werden zentrale Fragestellungen der Regulatorik in die Praxis ausgespielt (regulatorisches Lernen).
Zum Reallabor

FoResLab - Future Lab towards Forests Resilient to Climate Change
Das Verbundvorhaben "Future Lab towards Forests Resilient to Climate Change" soll als neue Plattform in Niedersachsen dienen, um in einem inter- und transdisziplinären Ansatz die Frage zu beantworten: Wie können Wälder unter heutigen und zukünftigen Bedingungen resilient gegenüber Klimaveränderungen gemacht werden? Die Innovation des Reallabors besteht insbesondere im integrativen Ansatz: Organisiert in drei Plattformen und 13 Teilprojekten wird FoResLab neue Wege der inter- und transdisziplinären Forschung, der Wissenschaftskommunikation und des Wissenstransfers beschreiten. In der experimentellen Plattform sollen relevante Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen an sechs Versuchsstandorten mit neuester Fast-Echtzeit-Sensorik untersucht werden, um multifunktionale Indikatoren für die Resilienz der Wälder gegenüber dem Klimawandel abzuleiten Die experimentelle Plattform dient der Unterstützung und Validierung der digitalen Plattform, die mithilfe von luft- und weltraumgestützten Fernerkundungs- sowie Modellierungsansätzen zwei Online-Produkte liefern wird, die für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollen: (1) Digitale Zwillinge der Versuchsstandorte und (2) ein Online-Wald-Wasserstress-Monitor. Die Gesellschaftsplattform fördert die transdisziplinäre Forschung, regt Synthese-Veröffentlichungen an und gewährleistet eine umfassende Einbeziehung der Interessengruppen.
Zum Reallabor

Reallabor Großenhain: Die "Freundliche Übernahme" als Modellprojekt zur Gestaltung des Generationenwechsels im Einzelhandel
Innenstädte stehen vor einem tiefgreifenden strukturellen Wandel im innerstädtischen Einzelhandel. In den kommenden zwei Jahren werden rund ein Zehntel der bestehenden inhabergeführten Ladengeschäfte altersbedingt schließen. Bis 2030 könnte dieser Anteil auf bis zu 50 % steigen. Diese Entwicklung ist Ausdruck eines flächendeckenden Generationenwechsels, wie er deutschlandweit zu beobachten ist. Deshalb wurde in Großenhain das Reallabor "Freundliche Übernahme" initiiert – ein Entwicklungs- und Kooperationsprojekt, das den Übergang in eine neue Einzelhandelsgeneration aktiv begleiten und nachhaltige Lösungsansätze für die Reaktivierung von Leerständen entwickeln will. Hierfür kommt unter anderem eine digitale Matchingplattform zum Einsatz, die Angebot und Nachfrage systematisch zusammenführt – ergänzt um ein mentorenbasiertes Unterstützungsprogramm, inklusive niedrigschwelliger Gründungsberatung, rechtlicher Beratung, Pop-up-Nutzung sowie Testphasen unter realen Bedingungen in bestehenden Ladenflächen. Das Projekt wird in Kooperation mit der bundesweiten Initiative "Die Stadtretter" umgesetzt. Ziel ist es, erprobte Methoden, digitale Werkzeuge sowie ein überregionales Netzwerk in das lokale Projektgeschehen zu integrieren. Ergänzt wird dies durch qualitative Vor-Ort-Erhebungen und einen systematischen Austausch zwischen Stadtverwaltung, Wirtschaftsförderung, Einzelhandel und Zivilgesellschaft.
Zum Reallabor

KIRA (KI-basierter Regelbetrieb autonomer On-Demand-Verkehre)
Autos fahren selbständig mit Regelgeschwindigkeit im normalen Straßenverkehr – das ist bereits Realität im Rhein-Main-Gebiet. Das Pilotprojekt KIRA "KI-basierter Regelbetrieb autonom fahrender On-Demand-Verkehre" startet in Teilen der Stadt Darmstadt und des Kreises Offenbach. Autonomes Fahren ist ein entscheidender Baustein für den Ausbau des ÖPNV - besonders in Zeiten des Fahrermangels. Die elektrisch betriebenen und über eine App buchbaren On-Demand-Shuttles sind besonders im ländlichen und kleinstädtischen Raum ein wichtiger Bestandteil des ÖPNV-Angebots. Initiatoren des Projektes sind der Rhein-Main-Verkehrsverbund und die Deutsche Bahn. Ziel des Projekt ist es, Erfahrungen im Level 4-Erprobungsverkehr und den Herausforderungen rund um Projektaufsatz, Genehmigungsprozesse und Betrieb zu sammeln. Außerdem beleuchtet das Reallabor die Frage, wie die Integration autonomer Fahrzeuge in den bestehenden ÖPNV ausgestaltet werden kann.
Zum Reallabor

R_Lab Mobilität
Regensburg ist mit REGENSBURG_NEXT Teil des bundesweit größten Smart-City-Förderprogramms "Modellprojekte Smart Cities". Damit gehört die Stadt zu insgesamt 73 "Experimentierorten" der integrierten Stadtentwicklung, die von der Bundesregierung gefördert werden. Mit dem Reallabor wurde 2024 ein Erprobungsraum für smarte Mobilitätsanwendungen geschaffen, um Lösungen für die Herausforderungen im Bereich Mobilität entwickeln und erproben zu können. Die Stadt Regensburg hat das Cluster Mobility & Logistics damit beauftragt, das R_Lab Mobilität zu managen. Ziel ist es, mit den beteiligten Akteuren aus Verwaltung, städtischen Töchtern, Wissenschaft und Industrie Smart-City-Anwendungen unter realen Bedingungen zu testen und innovative Mobilitätslösungen aus der Theorie in die Praxis zu bringen. Die im R_Lab Mobilität erhobenen Daten werden zentral gespeichert und Projektbeteiligten für Forschungs- und Entwicklungszwecke zur Verfügung gestellt. Dafür wird federführend durch das Stadtwerk.Regensburg ein erster Prototyp eines Data Hubs für Mobilitätsdaten entwickelt. Anwendungsprojekte (Stand 03/2025 - weitere sind geplant): Projekt SDP Smart Dynamic Public Lighting (sdp GmbH) Projekt DARuV Digitale Analyse des ruhenden Verkehrs (DCX Innovations GmbH) Projekt ReSense3D (digitalwerk GmbH, NewSense Engineering GmbH) Projekt Umweltsensorboxen (AVL Software and Functions GmbH)
Zum Reallabor

Greenstage
Greenstage erforscht nachhaltige Transformationsprozesse in den darstellenden Künsten. Ziel ist es, Kulturinstitutionen dabei zu unterstützen, nachhaltige Produktionsweisen zu entwickeln. Dabei werden ökologische, sozio-kulturelle und wirtschaftliche Aspekte betrachtet. Eine zentrale Innovation ist das SAPA-Tool (Sustainability Assessment for the Performing Arts), ein speziell für den Kulturbereich entwickeltes dialogbasiertes Selbstbewertungsinstrument, das Kulturinstitutionen ermöglicht, ihren Status quo zu analysieren und gezielte Maßnahmen abzuleiten. Das SAPA -Tool wird in einem Co-kreativen Prozess mit Theatern und Kommunen aus fünf europäischen Ländern erarbeitet und unter realen Bedingungen erprobt. Derzeit wird es bereits in analoger Form von den beteiligten Theatern getestet. Nach der ersten Testphase wird es digital zur Verfügung gestellt. Zudem entsteht ein Zero-Waste-Stage-Toolkit, das ressourcenschonende und kreislauffähige Produktionsabläufe in Kulturinstitutionen fördern soll. Dieses wird 2026 bei einem Zero Waste-Festival in Ljubljana erprobt. Beide Tools werden online auf greenstage.eu zur Verfügung gestellt.
Zum Reallabor
ClimateHOOD_CampusPARK Charlottenburg
Der Campus Charlottenburg ist ein Reallabor der Transformation. Mit vielen Experimenten und innovativen Lösungen wird hier gezeigt, wie Klimaschutz und Klimaanpassung gestaltet werden können. Im Rahmen des Projektes ClimateHOOD_CampusPARK Charlottenburg werden auf dem TU-Campus bauliche Maßnahmen durchgeführt: Von ausgewählten Dächern soll Regenwasser abgeleitet und zwischengespeichert werden, um für verschiedene Nutzungen zur Verfügung zu stehen. In die Umsetzung fließen unter anderem Ergebnisse aus der Roof Water-Farm ein. Nach dem Prinzip der Schwammstadt sollen Retentionsräume auf Dächern, an Fassaden und als Freiflächen der TU Berlin entwickelt werden (CampusPARK). Ober- und unterirdische Zisternen halten das Regenwasser zurück, genauso wie natürliche grün-blaue Schwammstrukturen wie Schilfbeete, Fassadenbegrünungen und Vertikalfarmen. Diese sollen als produktive und regenerative Bewirtschaftungsflächen der Klima- und Kreislaufstadt getestet und weiterentwickelt werden. Das Regenwasser wird so in einen natürlichen Kreislauf überführt und kühlt den städtischen Raum. Für die Konzeption und Umsetzung dieser Maßnahmen ist das Reallaborzentrum der TU, die StadtManufaktur Berlin in enger Kooperation und Projektkoordination mit dem Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf verantwortlich.
Zum Reallabor

Digitalisierung für nachhaltige Mobilität (DiNaMo)
Ziel von DiNaMo ist es, Maßnahmen zur Förderung eines nachhaltigen Mobilitätsverhaltens durch Digitalisierung zu entwickeln, zu pilotieren und Erfolge bzw. Hemmnisse an den beteiligten Einrichtungen zu erfassen. Im Projekt kooperieren drei Hochschulen (Hochschule Hannover, Leibniz Universität Hannover und Medizinische Hochschule Hannover) sowie das Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek mit der Stadt und Region Hannover als assoziierte Partnerinnen und Partner. Die Hochschulen fungieren dabei als Reallabor innerhalb der Stadt, in das Studierende und Mitarbeitende im Sinne einer Co-Creation eingebunden werden. Im Projekt werden u. a. Ride-Sharing-Konzepte, AR-gestützte Gamificationansätze (AR=Augmented Reality) und die Förderung nachhaltiger Mobilitätsangebote erprobt. In einem transdisziplinären Design wird dabei an folgenden Teilzielen gearbeitet: Sammlung von Daten zum Mobilitätsverhalten aller Statusgruppen der Hochschule. Partizipative Erarbeitung und Erprobung von ausgewählten Maßnahmen sowie Anreizen zur Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen. Integration des Themas in interne und externe (Lehr-)Veranstaltungen der Hochschulen. Identifikation von Potenzialen und Hemmnissen bei der Integration und Nutzung von nachhaltigen, digital gestützten Mobilitätsangeboten. Transfer der Konzepte und Prinzipien an lokale Partnerinnen und Partner in der Stadt und Region Hannover.
Zum Reallabor

Reallabor Conceptstore/HOMie – Soziale Stadtentwicklung in Homburg
Das Reallabor Conceptstore/HOMie in Homburg ist ein interdisziplinärer Experimentierraum zur Erprobung neuer Ansätze sozialräumlicher Stadtentwicklung. Ziel ist es, gemeinsam mit lokalen Akteurinnen und Akteuren aus Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik innovative und lebensnahe Lösungen für die Gestaltung urbaner Räume zu entwickeln. Ausgangspunkt ist die Herausforderung, bestehende Infrastrukturen und soziale Netzwerke an veränderte demografische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen. Im Fokus stehen Teilhabe, nachbarschaftliches Engagement und nachhaltige Raumnutzung. Die Innovation liegt in der hybriden Nutzung innerstädtischer Flächen als nicht-kommerzielle Begegnungsorte, inklusive partizipativer Programmgestaltung, Integration sozialer Dienste und Plattformökonomie für lokale Produzentinnen und Produzenten innerhalb eines kommunal getragenen Geschäftsmodells. Die Nutzungsform wird im laufenden Innenstadtbetrieb getestet: In zentraler Lage werden Räume flexibel als Treffpunkt, Verkaufsfläche und Veranstaltungsort genutzt. Der Betrieb erfolgt durch lokale Akteurinnen und Akteure, ergänzt durch kommunale Unterstützung Das Reallabor arbeitet partizipativ und nutzt reale Stadträume als Forschungs- und Entwicklungsumgebung. Durch die Verbindung von wissenschaftlicher Begleitung, praktischer Umsetzung und Evaluation entstehen praxisnahe, übertragbare Lösungen.
Zum Reallabor

InBiRa – die Insektenbioraffinerie: Von der Verwertung organischer Reststoffe und Abfälle bis hin zur Herstellung von Produkten
Bei InBiRa wird erstmals eine Insektenbioraffinerie als Pilotanlage aufgebaut, in welcher organische Reststoffe und Abfälle mit Hilfe von der Larve der Schwarzen Soldatenfliege in neue, technisch nutzbare Produkte umgewandelt werden. Die Bestandteile der Schwarzen Soldatenfliege lassen sich vielseitig nutzen: Die Fettfraktion kann nach chemischer oder enzymatischer Umwandlung zu Schmierstoffen, Kraftstoffen, Biotensiden oder Seifen verarbeitet werden. Aufgrund ihres hohen Laurinsäuregehalts ähnelt sie Kokos- und Palmkernöl und stellt eine regionale Alternative zu tropischen Ölen dar. Die Proteinfraktion eignet sich zur Herstellung von Holzklebstoffen, Bindemitteln, Papierbeschichtungen und Verpackungsfolien. Hydrolysiertes Protein findet zudem Anwendung in Kosmetik- und Pflegeprodukten. Auch die Reststoffe wie Cellulose, Exkremente und Häutungsprodukte werden weiterverwertet – etwa zur Biogasproduktion, Düngemittelherstellung oder zur Isolierung von Chitosan, das z. B. in der Medizin, Kosmetik, Wasseraufbereitung oder als antimikrobielle Beschichtung in Verpackungen eingesetzt werden kann. Grundlage war das Projekt Insekten Bioraffinierie.
Zum Reallabor

NoWeL4 (NordWestraum Level 4)
Im Projekt NoWeL4 wird im Nordwesten Berlins der Einsatz automatisierter Fahrzeuge auf Autonomie-Level 4 erprobt. Fünf Fahrzeuge sollen in einem On-Demand-Betrieb eingesetzt und aus einer eigenen Leitstelle überwacht und betreut werden. Das Projekt strebt den Beweis dafür an, dass autonomes Fahren auf der Straße technisch funktioniert und bedarfsgerecht im urbanen Raum, auf öffentlicher Straße eingesetzt werden kann. Teilnehmende einer geschlossenen Nutzergruppe können Fahrten flexibel per App innerhalb eines definierten Bediengebiets buchen. So wird praxisnah untersucht, wie sich autonome Fahrzeuge in ein öffentliches, nachfragegesteuertes Verkehrsangebot integrieren lassen. Darüber hinaus wird die Akzeptanz und der Umgang der Nutzenden mit dem Angebot untersucht und die rechtlichen Voraussetzungen für die Integration der Technik in den Berliner ÖPNV wissenschaftlich erarbeitet. Derzeit läuft die Vorbereitung der Erprobung; der Betrieb ist noch nicht gestartet.
Zum Reallabor

SMART SPACE Hardenbergplatz | Vom Vor- zum Stadtplatz – smarte Räume gestalten und betreiben
Die Verwaltung des Berliner Hardenbergplatzes – insbesondere das Veranstaltungsmanagement – soll durch die zu gründende bezirkseigene Betreibergesellschaft "Urban Space GmbH" (USG) erprobt werden. Über eine Online-Verhandlungsplattform, auf der Interessierte ihre Veranstaltungen buchen können, wird die Nutzung ausgewiesener Flächen auf dem Hardenbergplatz möglich. Mithilfe künstlicher Intelligenz und unter Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben werden die gebuchten Veranstaltungen hinsichtlich ihres Gemeinwohlbeitrags geprüft. Veranstaltungen mit dem höchsten Gemeinwohlpotenzial erhalten im Fall mehrerer Buchungen für einen Slot den Zuschlag. Für Veranstalterinnen und Veranstalter vereinfacht sich das Verfahren deutlich. Die Bewerbung erfolgt vollständig online und wesentlich schneller als bei einer herkömmlichen Sondernutzungsgenehmigung. Dies wird unter anderem durch die Erteilung einer Rahmensondernutzungserlaubnis durch das zuständige Bezirksamt ermöglicht. Auch für die Verwaltung wird der Prozess effizienter, da Anfragen auf vordefinierte Nutzungsschemata Bezug nehmen und zusätzlich durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz unterstützt werden.
Zum Reallabor

Reallabor autonome Arbeitsmaschinen
Im Reallabor für autonome Arbeitsmaschinen in Ilmenau werden innovative Technologien für den autonomen Betrieb von mobilen Arbeitsmaschinen und Unterstützungssystemen erforscht und erprobt – praxisnah und unter realen Bedingungen. Ziel ist es, die Automatisierung mobiler Arbeitsmaschinen voranzutreiben und deren Einsatz in komplexem, unwegsamem Gelände zu ermöglichen. Auf dem 6000 m² großen, gesicherten Gelände mit unterschiedlichen Untergründen können solche Systeme realitätsnah getestet und validiert werden. Unterstützt wird dies durch ein leistungsfähiges 5G-Campusnetz, moderne Referenzmesstechnik und Möglichkeiten zur Edge-Datenverarbeitung. Das Reallabor bietet auch externen Partnern die Chance, eigene Technologien unter praxisnahen Bedingungen zu testen oder gemeinsam mit dem Team des Reallabors weiterzuentwickeln.
Zum Reallabor

Multikopter in der Luftrettung - Dinkelsbühl-Sinbronn
Bemannte Multikopter sind neue, senkrechtstartende Luftfahrzeuge mit mehreren elektrisch angetriebenen Rotoren. Bisher wurden die Fluggeräte in erster Linie als Flugtaxis im zivilen Bereich entwickelt. Die ADAC Luftrettung hat weltweit die erste Machbarkeitsstudie zu Multikoptern im Rettungsdienst veröffentlicht und so erstmalig deren einsatztaktischen Vorteil theoretisch belegt: Mit Multikoptern können Notärzte nicht nur schneller am Einsatzort sein, sondern auch deutlich mehr Patienten in einem größeren Versorgungsgebiet erreichen. Die Arbeit des Mediziners wird so effektiver und der Multikopter zu einem Mittel im Kampf gegen den vielerorts herrschenden Notarztmangel. Auch der Rettungshubschrauber kann noch effektiver eingesetzt werden, denn er fungiert heute in rund 60 Prozent der Fälle als reiner Notarztzubringer. Er kann stattdessen sein Potenzial als Transportmittel in weiter entfernte (Spezial-)Kliniken ausschöpfen. Auch dies verbessert die Notfallversorgung der Menschen. Im Reallabor werden bereits erste technische Tests mit dem Hersteller Volocopter durchgeführt. Sobald die Musterzulassung des Luftfahrzeuges erwirkt wurde, werden die Erprobungen gemeinsam mit den Luftfahrtbehörden und den beteiligten Projektpartnern intensiviert und anhand realer Einsätze durchgeführt. Dafür werden an zwei Standorten Pilotbetriebe aufgebaut, um ausgiebig die Eignung dieses neuen Luftrettungssystems zu testen und den Weg für einen großflächigen deutschlandweiten Rollout zu ebnen.
Zum Reallabor

REAKT - innovativer Schienenverkehr auf stillgelegten Schienenstrecken in ländlichen Regionen
Im Reallabor REAKT will die gleichnamige Forschungsinitiative neuartige Schienenfahrzeuge und Streckenkonzepte testen, mit denen stillgelegte Schienenstrecken reaktiviert werden könnten. So soll z. B. untersucht werden, wie auf eingleisigen Strecken mit autonomen Fahrzeugen on-demand Begegnungsverkehr realisiert werden kann. Daneben werden neuartige Konzepte für Bahnübergänge, Stellwerke und Bahnsteige erprobt, die auf digitalen Technologien und moderner Sensorik basieren. Erstes Testgebiet ist die 17 km lange Strecke Malente - Lütjenburg in Schleswig-Holstein nahe der Ostseeküste. Im Reallabor sollen die technische Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit der Technologien nachgewiesen werden. Hervorgegangen ist das Reallabor aus dem 2020 gegründeten Verein Schienenverkehr Malente-Lütjenburg e.V. (SML) und der sich aus dem Beirat Bahntechnik Schleswig-Holstein heraus entwickelten REAKT-Forschungsinitiative, welche ein großes Netzwerk aus Hochschulen, Industriepartnern, Kommunen und Verbänden beinhaltet. Ab 2025 wird die Entwicklung der REAKT-Innovationscommunity durch das BMBF unterstützt, als eine von zwanzig Innovationscommunities unter knapp 500 Bewerbungen. Die Federführung liegt bei der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU).
Zum Reallabor
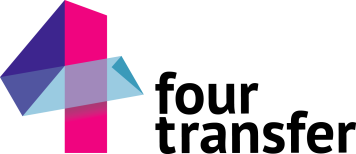
Reallabor Holzbau
Ziel des Reallabors Holzbau ist es, innovative Ansätze aus der Forschung schneller in die Praxis zu bringen, die notwendigen Zustimmungsverfahren durch Standardisierung zu vereinfachen und so den Holzbau voranzutreiben. Dieser Ansatz dient als Innovationsbooster in der heute aufgrund restriktiver Regulatorien konservativen und innovationsträgen Bauwirtschaft. Das Reallabor Holzbau ist Teil des Innovationsverbund 4transfer, das den Wissens- und Technologietransfer in Sachsen fördert und innovative Lösungen entwickelt. Im Rahmen dieses Projekts wurde das Reallabor Holzbau an der Dualen Hochschule Sachsen am Standort Dresden initiiert. Für 4transfer sind Reallabore experimentelle Forschungs- und Entwicklungsumgebungen, in denen neue Ideen, Technologien und Prozesse unter realen Bedingungen und über einen längeren, aber begrenzten Zeitraum getestet werden. Sie dienen, dem Quadruple-Helix-Ansatz folgend, als Plattform für die Zusammenarbeit und das gemeinsame Lernen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung / Politik. Ziel ist es, unter Zuhilfenahme von Ausnahmeregelungen, wie beispielsweise Experimentierklauseln, innovative Lösungen für komplexe gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln und zu erproben.
Zum Reallabor

Multikopter in der Luftrettung - Idar-Oberstein
Bemannte Multikopter sind neue, senkrechtstartende Luftfahrzeuge mit mehreren elektrisch angetriebenen Rotoren. Bisher wurden die Fluggeräte in erster Linie als Flugtaxis im zivilen Bereich entwickelt. Die ADAC Luftrettung hat weltweit die erste Machbarkeitsstudie zu Multikoptern im Rettungsdienst veröffentlicht und so erstmalig deren einsatztaktischen Vorteil theoretisch belegt: Mit Multikoptern können Notärzte nicht nur schneller am Einsatzort sein, sondern auch deutlich mehr Patienten in einem größeren Versorgungsgebiet erreichen. Die Arbeit des Mediziners wird so effektiver und der Multikopter zu einem Mittel im Kampf gegen den vielerorts herrschenden Notarztmangel. Auch der Rettungshubschrauber kann noch effektiver eingesetzt werden, denn er fungiert heute in rund 60 Prozent der Fälle als reiner Notarztzubringer. Er kann stattdessen sein Potenzial als Transportmittel in weiter entfernte (Spezial-)Kliniken ausschöpfen. Auch dies verbessert die Notfallversorgung der Menschen. Im Reallabor werden bereits erste technische Tests mit dem Hersteller Volocopter durchgeführt. Sobald die Musterzulassung des Luftfahrzeuges erwirkt wurde, werden die Erprobungen gemeinsam mit den Luftfahrtbehörden und den beteiligten Projektpartnern intensiviert und anhand realer Einsätze durchgeführt. Dafür werden an zwei Standorten Pilotbetriebe aufgebaut, um ausgiebig die Eignung dieses neuen Luftrettungssystems zu testen und den Weg für einen großflächigen deutschlandweiten Rollout zu ebnen.
Zum Reallabor

Mannheim Medical User Experience and Usability Innovations Labor (M²AXI Usability Labor)
Das Mannheim Medical User Experience and Usability Innovations-Labor (M2AXI Usability Labor) dient als kontrollierte Umgebung für die Evaluierung und die Testung digitaler Produkte im Bereich der Medizin, wie beispielsweise medizinische Geräte, Software und mobile Anwendungen. Es befindet sich im Herzen des Universitätsklinikums Mannheim (UMM) und erleichtert dadurch die direkte Zusammenarbeit mit Interessengruppen für Medizinprodukte wie ärztliches Personal und Patientinnen und Patienten. Im Reallabor werden unterschiedliche Projekte an der Schnittstelle zwischen medizinischer Produkt- und Softwareentwicklung durchgeführt. Beispielsweise wurden im Rahmen des Projekts "ENABLE" (Nachsorge-App für Patientinnen nach einer Brustkrebserkrankung) untersucht, wie intuitiv Patientinnen die App bedienen können, ob die Darstellung von Therapieinformationen verständlich ist und inwiefern Erinnerungs- und Monitoring-Funktionen zuverlässig genutzt werden. In realitätsnahen Szenarien konnten Hinweise zu Barrieren in der Nutzung (zum Beispiel alters- oder krankheitsbedingte Einschränkungen, Informationsüberflutung) sowie zu Verbesserungen im Interaktionsdesign gewonnen werden. Das M²AXI Usability Labor gehört zum Mannheimer Ökosystem der medizintechnischen Reallabore. Die Einrichtung steht allen Forschenden der UMM offen – aber auch externe Akteure wie Start-ups, größere Unternehmen oder wissenschaftliche Forschungsgruppen anderer Hochschulen können das Labor nutzen.
Zum Reallabor

SInBa Reallabor Mannheim
Das SInBa-Projekt untersucht die Rolle von sozialen Innovationen bei der Umsetzung von Klima- und Nachhaltigkeitszielen im Bauen und Wohnen. In Mannheim werden soziale Innovationen für eine flächensparende, klimagerechte Wohnraumversorgung erprobt. Wohnraummanagement: Mannheim hat ein finanzielles Anreizsystem in Form einer Wohnraumtauschprämie eingeführt. SInBa begleitet die Maßnahme und entwickelt mit der Verwaltung Aktivierungsstrategien, um daran anknüpfend die Stadtgesellschaft für die individuellen Wohnraumverhältnisse zu sensibilisieren sowie Anreize zur Veränderung im Sinne einer Wohnflächensuffizienz zu schaffen. Fahrplan Nachverdichtung: Der wachsende Wohnraumbedarf erzeugt einen Umsetzungsdruck in der Schaffung von ausreichenden, bezahlbaren Wohnungen. Dabei spielen auch städtische Vorschriften eine Rolle und die Frage, inwieweit Handlungsspielräume für andere Vorgehensweisen vorhanden sind. Ziel ist einen Austausch zwischen Verwaltung, Akteurinnen und Akteuren zu etablieren, der diese Spielräume am Beispiel eines Vorhabens auslotet und Lösungsoptionen aufzeigt. Profipilot: Ziel der Sozialen Innovation ist die Entwicklung eines Piloten für eine Nahwärmeinsel in einem Mannheimer Quartier. Der Kerngedanke dabei ist, nicht mit vielen Einzeleigentümerinnen und -eigentümern anzufangen, sondern mit "Profis", wie Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Der Pilot soll einen möglichen Weg aufzeigen und das Interesse von Einzeleigentümerinnen und -eigentümern wecken.
Zum Reallabor

SInBa Reallabor Wuppertal
Das SInBa-Projekt untersucht die Rolle von sozialen Innovationen bei der Umsetzung von Klima- und Nachhaltigkeitszielen im Bauen und Wohnen. In Wuppertal werden soziale Innovationen erprobt, die die Entwicklung eines klimagerechten und klimaneutralen Gebäudebestandes unterstützen. Gemeinschaftliches Wohnen im Bestand: SInBa unterstützt und begleitet die Initiative Gemeinschaftliches Wohnen in Wuppertal (IGWW) bei der Realisierung eines gemeinschaftlichen Wohnprojekts in einer Bestandsimmobilie. Hierbei sollen sowohl Unterstützungsmöglichkeiten für gemeinschaftliche Wohnprojekte als auch Handlungsoptionen im Umgang mit Bestandsimmobilien ausgelotet werden. Kooperative Nahwärmeversorgung im Quartier: SInBa unterstützt und begleitet Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mieterinnen und Mieter in der Elberfelder Nordstadt, die sich als Arbeitsgruppe „Wärmewende im Quartier“ selbst organisieren, um gemeinschaftliche Lösungen für die Energie- und Wärmeversorgung ihrer häufig denkmalgeschützten Gebäude zu finden. Der Fokus liegt hierbei auf einer möglichen Nahwärmelösung am Ölberg. Pre- und Reboundeffekte beim Heizverhalten von Transferleistungsempfangenden: SInBa untersucht am Beispiel des Wohnparks Schellenbeck das Heizverhalten von Transferleistungsempfangenden, um der Wohnungswirtschaft zu helfen, zielgerichteter auf die Bedürfnisse der Zielgruppe eingehen zu können und um kommunalen Grundsicherungsträgern Impulse für die Ausgestaltung der Kosten der Unterkunft zu geben.
Zum Reallabor

NUMIC 2.0 - Neues urbanes Mobilitätsbewusstsein in Chemnitz
Das Projekt von der TU und der Stadt Chemnitz forschte über die Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung. Verbesserte Beteiligungen versprechen einen neuen Austausch zwischen Bürgerschaft und Verwaltung in der Planung und erhöhen dabei das nachhaltige Mobilitätsbewusstsein. Dafür wurden in Chemnitz neue Formate (wie z. B. Virtual-Reality-Technologien) an Beteiligungen zukünftiger Verkehrsprojekte erprobt. Das Projekt sollte Handlungsempfehlungen für Beteiligungen erarbeiten für Chemnitz und interessierte Kommunen. Konkret ging es zum Beispiel beim Reallabor "Nevoigtstraße" – im Sinne aller durchgeführten Beteiligungsprozesse – darum, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden eine sichere Verkehrssituation für alle zu schaffen. Die Ausgangslage war durch einen hohen Parkdruck geprägt, was zu verkehrswidrigem Verhalten wie etwa Falschparken führte. Ein neues Verkehrs- und Parkraumkonzept war daher erforderlich. Dieses wurde im Rahmen mehrerer Veranstaltungen und in unterschiedlichen Beteiligungsformaten entwickelt – zunächst mithilfe eines 10 Meter langen Luftbilds der Nevoigtstraße im Maßstab 1:87, auf dem unter anderem Fahrzeuge, Verkehrsanlagen und weitere Elemente abgebildet waren. Gemeinsam mit den Beteiligten wurden auf dieser Grundlage drei Varianten erarbeitet. Diese wurden aus verkehrsplanerischer Sicht auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, entsprechend angepasst und anschließend zur Abstimmung gestellt.
Zum Reallabor

Klimapakt2030plus - Energiewende in der Metropolregion Nürnberg
Das BMFTR-Pilotprojekt Klimapakt2030plus untersucht am Beispiel der Metropolregion Nürnberg, wie Metropolregionen mit neuen Strukturen und Initiativen zur Beschleunigung der Energiewende beitragen können. Im Fokus stehen die beiden Reallabore "Transformation Energieversorgung" und "Transformation Gebäudebestand". Gemeinsam mit den regionalen Akteuren aus kommunaler und staatlicher Verwaltung, Politik, Unternehmen, Energieversorgern, Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden Strukturen, Informationsbedarfe, Projektansätze oder Werkzeuge identifiziert, die zur Beschleunigung des Aufbaus einer erneuerbaren Energieversorgung oder der Steigerung der energetischen Gebäudesanierungsquote beitragen können. In Experimentierräumen werden mit den Akteuren neue Lösungen entwickelt und praktisch erprobt, z. B. interkommunale Energiegemeinschaften oder Konzeption eines One-Stop-Shops als Anlaufstelle für Sanierungsfragen. Technologische Unterstützung liefert ein neuartiges Simulations- und Beratungstool für Energieflüsse. Das Tool visualisiert die komplexen Zusammenhänge der regionalen Energiewende in einem sektorgekoppelten Modell (Strom, Wärme, Mobilität). Die sozial-ökologische Begleitforschung evaluiert die Experimente und sichert die Skalier- und Übertragbarkeit der Innovationen. Außerdem tauscht sich das Reallabor mit den zuständigen Fachstellen bei den Bezirksregierungen aus, welche Maßnahmen zu Bürokratieabbau und Verfahrensbeschleunigung vor allem auf Landesebene umsetzbar wären.
Zum Reallabor

SONa - Stadtzentren als Orte nachhaltigen Konsums - Post-Corona-Zeit als Chance für zukünftige Konsumkulturen - Duisburg
Städte unterliegen einem konstanten Wandel. Das wachsende Bewusstsein für urbane Grünflächen und Naherholungsgebiete sowie der Einfluss auf städtische Wirtschaftsstrukturen erzeugten neue und veränderte Ansprüche an den Stadtraum. Hinzu kommt der drohende Funktionsverlust der Innenstädte, der Planerinnen und Planer sowie Kommunen vor große Herausforderungen stellt. Der wachsende Leerstand von Einzelhandelsflächen in den Stadtzentren und die seit Jahren wachsende Wohnraumknappheit bei gleichzeitig steigenden Mietpreisen verlangt danach, den urbanen Raum auch im Stadtzentrum neu zu denken. An dieser Stelle setzt das Vorhaben SONa an: Es erprobt die Rolle nachhaltiger Konsumangebote in der Transformation der Innenstädte in drei lokalen Pilotprojekten. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass Stadtzentren als Orte nachhaltigen Konsums nicht nur nachhaltige Konsumkulturen fördern, sondern auch Orte der Gemeinschaft schaffen und eingebettet in eine umweltverträgliche Stadtentwicklung sind. In den Pilotprojekten werden u. a. folgende Innovationen erprobt: Duisburg: Belebung eines Ladenleerstands über den "DBI-Store" mit sorgfältig kuratiertem Sortiment lokaler und nachhaltiger Produkte begleitet durch eine Gründungsberatung Schwentinental: Belebung eines Ladenleerstands in der Innenstadt mit der "Pop-Up-Store"-Kleidertauschbörse inklusive Do-It-Yourself Schneiderei Würzburg: Informations- und Aufklärungsangebote zu Nachhaltigkeit und um soziale Begegnung in der Stadt zu etablieren
Zum Reallabor

EASYplus (Electric Autonomous Shuttle for You)
Gemeinsam mit dem Fahrzeughersteller EasyMile, dem Softwarepartner ioki und lokalen Partnern hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) erstmals zwei vollelektrische, automatisierte Shuttles mit On-Demand-Funktion auf öffentlichen Straßen im Rhein-Main-Gebiet eingesetzt. Dabei konnte eine Vielzahl an betrieblichen und technischen Erkenntnissen für zukünftige autonome Angebote im ÖPNV gewonnen werden. An 262 Betriebstagen haben die beiden EZ10 Gen3-Shuttles des Herstellers EasyMile insgesamt 3.792 Kilometer zurückgelegt und 1.848 Fahrten erfolgreich durchgeführt. Über den gesamten Projektzeitraum wurden 2.994 Fahrgäste sicher an ihr Ziel befördert. Autonome On-Demand-Verkehre sollen zukünftig ein wichtiger Bestandteil des Mobilitätsangebots im Verbundgebiet des RMV werden und zur Vereinbarung von Mobilität und Klimaschutz im ÖPNV beitragen. In der Summe haben die Fahrgäste ihre Fahrt in der Buchungsapp mit 4,8 von 5-Sternen bewertet. Die vielen positiven Rückmeldungen verdeutlichen das Potenzial autonomer Mobilität. Nach fast einem Jahr Betrieb im Frankfurter Stadtteil Riederwald wurde das Projekt EASYplus Ende Oktober 2023 erfolgreich abgeschlossen. EASYplus war Teil des EU-Förderprojektes SHOW.
Zum Reallabor

SONa - Stadtzentren als Orte nachhaltigen Konsums - Post-Corona-Zeit als Chance für zukünftige Konsumkulturen - Schwentinental
Städte unterliegen einem konstanten Wandel. Das wachsende Bewusstsein für urbane Grünflächen und Naherholungsgebiete sowie der Einfluss auf städtische Wirtschaftsstrukturen erzeugten neue und veränderte Ansprüche an den Stadtraum. Hinzu kommt der drohende Funktionsverlust der Innenstädte, der Planerinnen und Planer sowie Kommunen vor große Herausforderungen stellt. Der wachsende Leerstand von Einzelhandelsflächen in den Stadtzentren und die seit Jahren wachsende Wohnraumknappheit bei gleichzeitig steigenden Mietpreisen verlangt danach, den urbanen Raum auch im Stadtzentrum neu zu denken. An dieser Stelle setzt das Vorhaben SONa an: Es erprobt die Rolle nachhaltiger Konsumangebote in der Transformation der Innenstädte in drei lokalen Pilotprojekten. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass Stadtzentren als Orte nachhaltigen Konsums nicht nur nachhaltige Konsumkulturen fördern, sondern auch Orte der Gemeinschaft schaffen und eingebettet in eine umweltverträgliche Stadtentwicklung sind. In den Pilotprojekten werden u. a. folgende Innovationen erprobt: Duisburg: Belebung eines Ladenleerstands über den "DBI-Store" mit sorgfältig kuratiertem Sortiment lokaler und nachhaltiger Produkte begleitet durch eine Gründungsberatung Schwentinental: Belebung eines Ladenleerstands in der Innenstadt mit der "Pop-Up-Store"-Kleidertauschbörse inklusive Do-It-Yourself Schneiderei Würzburg: Informations- und Aufklärungsangebote zu Nachhaltigkeit und um soziale Begegnung in der Stadt zu etablieren
Zum Reallabor

SONa - Stadtzentren als Orte nachhaltigen Konsums - Post-Corona-Zeit als Chance für zukünftige Konsumkulturen - Würzburg
Städte unterliegen einem konstanten Wandel. Das wachsende Bewusstsein für urbane Grünflächen und Naherholungsgebiete sowie der Einfluss auf städtische Wirtschaftsstrukturen erzeugten neue und veränderte Ansprüche an den Stadtraum. Hinzu kommt der drohende Funktionsverlust der Innenstädte, der Planerinnen und Planer sowie Kommunen vor große Herausforderungen stellt. Der wachsende Leerstand von Einzelhandelsflächen in den Stadtzentren und die seit Jahren wachsende Wohnraumknappheit bei gleichzeitig steigenden Mietpreisen verlangt danach, den urbanen Raum auch im Stadtzentrum neu zu denken. An dieser Stelle setzt das Vorhaben SONa an: Es erprobt die Rolle nachhaltiger Konsumangebote in der Transformation der Innenstädte in drei lokalen Pilotprojekten. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass Stadtzentren als Orte nachhaltigen Konsums nicht nur nachhaltige Konsumkulturen fördern, sondern auch Orte der Gemeinschaft schaffen und eingebettet in eine umweltverträgliche Stadtentwicklung sind. In den Pilotprojekten werden u. a. folgende Innovationen erprobt: Duisburg: Belebung eines Ladenleerstands über den "DBI-Store" mit sorgfältig kuratiertem Sortiment lokaler und nachhaltiger Produkte begleitet durch eine Gründungsberatung Schwentinental: Belebung eines Ladenleerstands in der Innenstadt mit der "Pop-Up-Store"-Kleidertauschbörse inklusive Do-It-Yourself Schneiderei Würzburg: Informations- und Aufklärungsangebote zu Nachhaltigkeit und um soziale Begegnung in der Stadt zu etablieren
Zum Reallabor

AVL Roding Wetterhalle
Das Sensortestzentrum Roding ist eine der ersten automotive Indoor-Testhallen in Deutschland. Im Testzentrum können unabhängige Sensortests für automatisierte Fahrzeuge durchgeführt werden. Die Tests erfolgen unter Einbezug von unterschiedlichen Wetter- und Verkehrsbedingungen. Für die Homologation decken diese zudem die bestehenden Anforderungen an Wiederholbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Dokumentation ab. Als konkretes Beispiel kann in der Wetterhalle die Notbremsfunktion (Euro NCAP AEB) in unterschiedlichen Lichtverhältnissen (Lichtintensität und Lichttemperatur) und Wetterbedingungen (Regen unterschiedlicher Intensität, Nebel unterschiedlicher Sichtweite) reproduzierbar getestet werden. Auf Basis dieser Tests können funktionale Verbesserungen im Bereich der Sensorik sowie der Entscheidungsfindung (Bremsen oder nicht) durchgeführt werden. Die Optimierung von aktiven Sicherheitsfunktionen und deren Sensorik in realen Umgebungsbedingungen ist deshalb so entscheidend, da die Unterstützung durch diese Assistenzfunktionen vor allem in Schlechtwettersituationen oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen am meisten benötigt wird. Für das autonome Fahren ist die Verfügbarkeit der Systeme zumindest bei leichtem und mittlerem Regen / Nebel sowie bei schlechten Lichtverhältnissen eine Grundvoraussetzung.
Zum Reallabor
ROUTINE
Das Reallabor ROUTINE schafft eine geschützte Testumgebung, in der ausgründungswillige Forschungsgruppen und kleine sowie mittlere Unternehmen (KMU) ihre KI-Anwendungen für das Gesundheitswesen unter realen Bedingungen erproben und zur Marktreife führen können. Im Sinne einer Regulatory Sandbox dient das Projekt gleichzeitig dazu, aus den praktischen Erfahrungen strukturiert die Rahmenbedingungen für KI in der Medizin zu verbessern. Die im Reallabor erprobte Innovation ist ein KI-gestützter Prädiktionsalgorithmus für die Geriatrie. Dieser analysiert Routinedaten von Patientinnen und Patienten nach einer Hüftfraktur. Darunter fallen Diagnosen, klinische Parameter und Funktions-Assessments. Auf dieser Basis prognostiziert die KI kritische Endpunkte wie das zukünftige Sturzrisiko, eine mögliche Verlängerung des Klinikaufenthalts oder die Wahrscheinlichkeit einer Entlassung in das eigene Zuhause. Zusätzlich wird untersucht, ob Daten aus einer sensorischen Aktivitätsmessung die Vorhersagekraft weiter steigern können. Der Mehrwert liegt in einer proaktiven Versorgungsplanung: Durch präzise Prognosen können Maßnahmen zur Sturzprävention, die Hilfsmittelberatung oder das Entlassmanagement frühzeitiger und gezielter eingeleitet werden. Dies erhöht die Behandlungsqualität sowie die Patientensicherheit und hilft, den Versorgungsprozess effizienter zu gestalten.
Zum Reallabor

Ostfalia, INBW, Wasserrückhalt zur Wiedervernässung von Hochmooren, Grabeneinstau, Gnarrenburg
In dem Reallabor geht es um die Erprobung einer Stauklappe, die im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Einstellen der Grabenwasserstände im Hochmoor entwickelt wurde. Die Stauklappe wird durch einen im Unterwasser liegenden Auftriebskörper gesteuert, der bei sinkendem Wasserspiegel den Abfluss aus dem Oberwasser und im Falle von einem höheren Wasserdruck im Oberwasser, beispielsweise durch Niederschläge, den Abfluss ermöglicht. Die Stauklappe erlaubt so, ohne externe Steuerung einen eingestellten Wasserhöhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasser zu erhalten und bei Veränderungen des Wasserstandes diesen Unterschied wieder herzustellen. Der Hintergrund ist der Bedarf Moorflächen, in diesem Falle Hochmoorflächen, zu vernässen, um die Degradation des Moorkörpers und die damit einhergehende Emission von klimaschädlichen Gasen zu verhindern beziehungsweise zu reduzieren. Da die meisten Hochmoorflächen in Niedersachsen als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden, soll die Stauklappe eine nassere Bewirtschaftung ermöglichen, bei der an zentralen Wehren der Wasserstand für größere Areale eingestellt werden kann.
Zum Reallabor

INSPIRE Living Lab
Das INSPIRE Living Lab am Universitätsklinikum Mannheim ist ein klinikintegriertes Reallabor, das Start-ups, Unternehmen und klinischen Akteurinnen und Akteuren die Möglichkeit bietet, digitale Gesundheitslösungen und medizintechnische Innovationen direkt im realen Versorgungsalltag einer Krankenhausstation zu erproben. Verschiedenste Berufsgruppen von Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten über IT und Datenschutz bis hin zu den Patientinnen und Patienten selbst können in die Tests einbezogen werden. Damit können Start-ups und Firmen ihre Produkte auf die Bedürfnisse ihre potenziellen Kunden direkt zuschneiden. Die Station ist so gestaltet, dass neue Produkte flexibel integriert und getestet werden können. Das INSPIRE Living Lab ist Teil des Mannheimer Modells, eines Netzwerks aus spezialisierten Reallaboren auf dem Campus der Universitätsmedizin Mannheim.
Zum Reallabor

Forschungs- und Flugerprobungszentrum für autonomes und elektrisches Fliegen und Boden-Luft gekoppelte Systeme
Das Reallabor AERO Lausitz bietet Rahmenbedingungen für Feldversuche und umfangreiche Tests mit elektrisch betriebenen Fluggeräten sowie mit Boden-Luft gekoppelten Systemen – auch außerhalb der Sicht (BVLOS). Es ist technologieoffen und ermöglicht Tests und Unterstützung für neue Mobilitäts- und Nutzungskonzepte. Dabei werden ganzheitliche Ansätze unter Beachtung technischer, ökonomischer, ökologischer wie auch gesellschaftlicher Nachhaltigkeit untersucht und erprobt. Angefangen von einfachen Test- und Zulassungsflügen neu entwickelter Systeme unter kontrollierten, aber realen Bedingungen, bis hin zu komplexen BVLOS-Szenarien mit Notfall- und Sicherheitskonzepten, kann das AEF Reallabor AERO Lausitz genutzt werden. In einem Projekt wurde die Datenübertragung einer Drohne über das Mobilfunknetz untersucht, während die Verbindung automatisch von einem Campusnetz auf öffentliche Netze wechselte. In einem anderen Experiment wurde die Mobilfunkqualität im untersten Luftraum (bis 100 m über Grund) großflächig vermessen und zeigte deutliche Abweichungen zur Empfangsqualität am Boden. Für diese und vergleichbare Erprobungen steht ein stetig wachsendes BVLOS-Gebiet inklusive benötigter Infrastruktur zur Verfügung, in dem leitstandsgeführte autonome Navigation, Schwarmanwendungen, Datenübertragungs- und -Sicherheitstests, technologische Erprobungen und Demonstrationen möglich sind.
Zum Reallabor

Karlsruher Forschungsfabrik für KI-integrierte Produktion
Gestützt auf neueste Methoden der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz überführen Wissenschaft und Industrie in der Karlsruher Forschungsfabrik innovative, herausfordernde Fertigungsverfahren gemeinsam und in kürzester Zeit von der Idee in die betriebliche Praxis. Ziel ist es, dass produzierende Unternehmen sowie Maschinen- und Anlagebauer den Markt schon sehr viel früher mit den neuen Produkten bedienen können. So können "unreife" – noch in der der Entwicklung befindliche – Prozesse deutlich schneller industrialisiert werden. Darüber hinaus sollen auch etablierte Prozesse durch den Einsatz intelligenter Methoden der Produktionstechnik und die Bündelung der Kompetenzen der Forschungspartner weiter verbessert werden. Die Karlsruher Forschungsfabrik für KI-integrierte Produktion wurde vom Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB), dem Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (ICT) sowie dem wbk Institut für Produktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gegründet und wird von den drei Forschungsinstituten gemeinschaftlich betrieben. Sie schafft die Möglichkeit, das Zukunftsthema "Intelligente Produktion" an realen Prozessen praxisnah zu erforschen.
Zum Reallabor

KI gestützte adaptive Straßenbeleuchtung zum Schutz der Biodiversität und zur Energieeinsparung
Im Reallabor KISBE wird eine innovative, KI-gestützte adaptive Straßenbeleuchtung unter realen Bedingungen erprobt. Ziel ist es, durch intelligente Steuerung und Sensorik die Beleuchtung bedarfsgerecht zu dimmen, um die Anlockwirkung auf Insekten zu reduzieren und gleichzeitig Energie einzusparen. Die Technologie nutzt verschiedene Sensoren, wie Wärmebildkameras und Bluetooth-Tracker, um das Verkehrsaufkommen zu erfassen und die Beleuchtung entsprechend anzupassen. Ein zentrales Element ist die Verwendung von Insektenkameras, die das Insektenaufkommen in der Nähe der Beleuchtung erfassen, ohne die Tiere zu schädigen. Durch die Kombination von zeitlicher und verkehrsabhängiger Dimmung soll die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet und gleichzeitig die Umweltbelastung minimiert werden. Das Projekt trägt somit zur Stärkung der biologischen Vielfalt und zur nachhaltigen Nutzung von Energie bei.
Zum Reallabor

SynergieQuartier Walldorf
Das Projekt SynergieQuartier hatte zum Ziel, auf begrenztem Raum die intelligente Vernetzung von Akteuren und digitalisierten technischen Systemen für eine kosteneffiziente und resiliente Energiewende zu erforschen. Herzstück des Projekts war ein Feldtest mit 28 Prosumer-Haushalten in Walldorf, die alle mit einem Energiemanagementsystem ausgestattet wurden. Darüber hinaus wurden Aspekte der IT-Sicherheit und der Resilienz in digitalisierten Energiesystemen sowie der Netzbetrieb mit flexiblen Anlagen im Verteilnetz untersucht.
Zum Reallabor
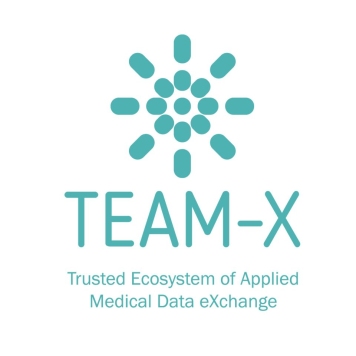
TEAM-X - Trusted Ecosystem of Applied Medical Data eXchange
Ziel von TEAM-X war die Schaffung eines geschützten und vertrauenswürdigen, digitalen Datenökosystems basierend auf der Gaia-X-Infrastruktur zur Entwicklung von datengetriebenen Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen. Es ist die Basis für eine zukunftsweisende Gesundheits- und Pflegeversorgung, die präventiv, personalisiert und partizipativ ist. Bislang unzugängliche Gesundheitsdaten wurden in diesem Rahmen verfügbar und nutzbar gemacht. Die Datenhoheit geht zu den Patientinnen und Patienten über. Sie bestimmen, wer Zugriff auf ihre Daten bekommt und wie diese verwendet werden. Lückenlose Dokumentation und Sicherheit spielten dabei eine große Rolle. Zugriff und Freigabe wurden von jedem Endgerät aus ermöglicht.Die bisher durch TEAM-X entwickelten Lösungen sind derzeit in zwei Anwendungsfällen praktisch abgebildet: CURE – Frauengesundheit CARE – die digitale Plattform,für stationäre und ambulante Altenpflege Basis zur Schaffung des digitalen Vertrauensraums für die Arbeit von TEAM-X bilden die auf europäischer Ebene entwickelten Digital Responsibility Goals.
Zum Reallabor
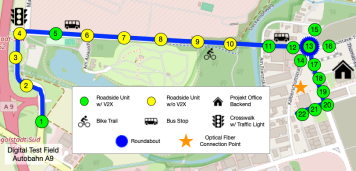
Digitales Testfeld "Erste Meile"
Das Reallabor Erste Meile ist eine offene, urbane Entwicklungs- und Demonstrationsplattform für 5G-basierte Mobilitätsanwendungen. Es verbindet den Ingolstädter Technologiepark IN-Campus mit dem Digitalen Testfeld Autobahn A9 und ist Teil der Mobilitätsregion Ingolstadt. Ziel ist die Erprobung und Erforschung zukunftsweisender Mobilitätssysteme unter realen Bedingungen. Im Fokus stehen die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Förderung nachhaltiger Mobilitätslösungen, Smart-City-Anwendungen sowie die Unterstützung der Entwicklung innovativer, vernetzter und automatisierter Fahrfunktionen. Das Reallabor erstreckt sich über ein 3,5 km langes Gebiet mit 22 Roadside Units an öffentlichen Straßen und einem Kreisverkehr. Diese sind mit insgesamt 89 Sensoren – darunter Kameras, RADAR und LiDAR –, V2X-Komponenten sowie leistungsfähiger IT ausgestattet und ermöglichen eine dichte Sensorabdeckung im öffentlichen Straßenraum. Die Roadside Units sind über Glasfaser mit einem leistungsstarken zentralen Backend verbunden und erlauben den bidirektionalen Netzwerkzugriff zum öffentlichen Internet. Die Software-Infrastruktur des Reallabors unterstützt eine hochperformante Verarbeitung und Fusion von Sensordaten, die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und in der Infrastruktur, zentrale Backend-Komponenten zur Datenverarbeitung sowie ein Dashboard zur Visualisierung und Analyse.
Zum Reallabor

ADAC Testzentrum Mobilität
im Testzentrum Mobilität werden die neuesten Fahrzeugmodelle und Systeme erprobt. Anhand dieser Tests entwickelt der ADAC Sicherheitsanforderungen an innovative Technik. Gesetzgeber in Berlin und Brüssel nutzen die Erkenntnisse und leiten daraus Vorgaben für Hersteller ab. Auf dem Testgelände werden unterschiedliche Module für Verbraucherschutz, Assistenzsysteme, autonomes Fahren, E-Mobilität und weitere Mobilitätsentwicklungen angeboten. Die Sicherheit künftiger Fahrzeuggenerationen wird durch die im Testzentrum Mobilität entwickelten Tests maßgeblich beeinflusst. So wurden neue Testverfahren zum Schutz von Radfahrenden bereits erfolgreich in Penzing entwickelt. Das ADAC Team simuliert komplexe Unfallsituationen am Fliegerhorst präzise, transparent und gefahrlos – mit modernster Technik und realistischen Attrappen. Neben gewerblichen Kunden nutzen auch Hochschulen aus der Region das Testzentrum. Im Rahmen von Kooperation mit dem Technologietransferzentrum Data Science und Autonome Systeme der TH Augsburg werden beispielsweise autonome Shuttles erprobt. Auch die TU München führt mit dem Forschungsfahrzeug EDGAR regelmäßig Tests durch und auch das ATLAS-L4 Förderprojekt profitierte von den Möglichkeiten. Derzeit wächst im Testzentrum Mobilität ein Netzwerk aus Hochschulen, technischen Diensten, Entwicklungsdienstleistern, Start-ups und Anbietern von Testtechnologien.
Zum Reallabor

Digitaler Heinerblock
Im Reallabor "Digitaler Heinerblock" untersucht das LOEWE-Zentrum emergenCITY, ein Forschungsverbund der Universitäten Darmstadt, Kassel und Marburg, wie die Transformation zu resilienten Stadtquartieren im Kontext nachhaltiger Stadtentwicklung aussehen kann. Dafür arbeitet es mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt zusammen, die im Lichtenbergblock einen urbanen Transformationsprozess angestoßen hat und in Anlehnung an die "Superblocks" Klimaresilienz und Verkehrssicherheit fördert. Ein Kernprojekt ist der Aufbau eines engmaschigen Sensornetzes mit 40 Boxen an Straßenlaternen. Diese erfassen Umwelt- und Flächennutzungsdaten, um Effekte der städtischen Maßnahmen zu analysieren. Sie dienen gleichzeitig als Testfeld für resiliente, drahtlose Kommunikation, die im Krisenfall Daten an Behörden übermittelt oder Informationen an Bürgerinnen und Bürger weitergibt. Zudem ist seit April 2025 die Litfaßsäule 4.0 in Erprobung – eine digitale Erweiterung für klassische Säulen, die auch bei Stromausfall informieren und warnen kann. Darüber hinaus forscht das Zentrum an der Visualisierung historischer und Echtzeitdaten, auch unter der Anwendung von AR- und VR-Technologien. Im Anwendungs- und Transferzentrum Digital Resilience Xchange (DiReX), das an der TU Darmstadt angesiedelt ist, soll der Digitale Heinerblock gemeinsam mit Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Behörden und Gesellschaft diskutiert sowie Weiterentwicklungsmöglichkeiten geprüft werden.
Zum Reallabor
Ostfalia, INBW, Campusnetzwerk 5G in der Landwirtschaft, Suderburg
In dem Reallabor wird erprobt, welche Vorteile die 5G Mobilfunktechnik auf Ackerflächen, insbesondere für die landwirtschaftliche Bewässerung, bringen kann. Bisher erprobt wurde der Einsatz 5G-fähiger Bodenfeuchtesonden, der Nutzen einer offenen Datenplattform und die Möglichkeiten dass eine 5G fähige Drohne bereits im Flug aufgenommene Multispektralbilder an die Datenplattform sendet. Aktuell laufen Versuche wie die empfangenen Daten mit KI optimiert bearbeitet werden können.
Zum Reallabor

eHUB
Im Reallabor eHUB entwickelt und erprobt das LOEWE-Zentrum emergenCITY, ein Forschungsverbund der Universitäten Darmstadt, Kassel und Marburg, innovative Lösungen zur Bewältigung eines langanhaltenden, überregionalen Stromausfalls. Die Forschenden untersuchen, wie sogenannte eHUBs, energieautarke, smarte Häuser, Städte und ihre Bewohnerinnen und Bewohner in solchen Krisen unterstützen können. Dazu wurde das ehemalige Solardecathlonhaus auf dem Campus Lichtwiese der TU Darmstadt technisch und baulich zum eHUB erweitert. Die Inselfähigkeit des eHUBs ermöglicht es, die aus der Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Dach und in der Fassade gewonnene Energie unabhängig vom lokalen Stromnetz zu nutzen. Bei einem Stromausfall ist somit ein autarker Notbetrieb möglich. Das gekoppelte Smart Home-System kann Warnmeldungen empfangen und Haustechnik automatisiert steuern, beispielsweise bei Gefahr Fenster und Türen automatisch schließen. Auch der Einsatz von Flugdrohnen zur Informationsübermittlung wurde erfolgreich getestet. Die Idee des eHUBs beschränkt sich jedoch nicht auf das Demonstratorgebäude der TU Darmstadt, sondern sieht einen eHUB-Verbund im Stadtraum vor, welcher eine ausfallsichere Kriseninfrastruktur vorhält. Daran kann sich jedes Gebäude mit PV-Anlage und Hausspeicher beteiligen, um die Notversorgung kritischer Infrastrukturen, die Informations- und Kommunikationsverbreitung, die Bereitstellung von Notstrom oder den Betrieb von Koordinationszentren mitzutragen.
Zum Reallabor

KI4PED - KI-basierte Optimierung von Fußgängerüberquerungszeiten durch smarte Lichtsignalanlagen
Lichtsignalanlagen für Fußgänger berücksichtigen bei Grünphasen oft nicht die benötigten Überquerungszeiten verschiedener Personengruppen. Auch zeigt sich, dass die Länge der Grünphasen Einfluss auf die Bereitschaft hat, diese während einer Rotphase zu überqueren. Intelligente Lösungsansätze zur frühzeitigen Erkennung von Fußgängern ermöglichen eine optimierte Signalsteuerung, sodass die Wartezeit verkürzt und zur Verkehrssicherheit beitragen werden kann. In diesem Projekt wurde ein innovativer Ansatz zur bedarfsgerechten Ansteuerung von LSA (Lichtsignalanlagen) für Fußgänger entwickelt, der aus einer Kombination aus 3D-LiDAR-Sensorik und KI-basierter Datenauswertung besteht. Damit kann eine berührungslose Bedarfsanforderungen für Fußgänger umgesetzt und die Wartezeit für diese reduziert werden. Zudem sollen durch diesen Ansatz verkehrswidrige Überquerungen während der Rotphase verringert werden. Es wurden an ausgewählten LSA-Standorten Daten mit 3D-LiDAR-Sensoren aufgezeichnet und auf dieser Grundlage eine KI-basierte Vorhersage der Überquerungsabsicht von Personen entwickelt. Ferner wurde die Integrierbarkeit in vorhandene LSA-Steuerungen untersucht und ein entsprechendes Steuerungsintegrationskonzept ausgearbeitet. Im Rahmen der Evaluation wurde die Eignung zur intelligenten LSA-Steuerung an den ausgewählten Standorten überprüft und die Robustheit gegenüber verschiedenen Lichtverhältnissen untersucht.
Zum Reallabor
Insekten Bioraffinerie
Die Hermetia Baruth züchtet die Schwarze Soldatenfliege (Hermetia illucens). Aus deren Larven können biobasierte Rohstoffe wie Fett und Protein gewonnen werden. Die Herstellung und der Energieeinsatz hierfür ist im Vergleich zu anderen Massentierhaltungen, um ein Vielfaches geringer, der Flächen- und Wasserbedarf ist reduziert. Außerdem bleiben keine Reststoffe zurück, die einem gesonderten Entsorgungspfad zugeführt werden müssen, sondern können als hochwertiger Dünger in den Kreislauf der Natur zurückgeführt werden. Ziel ist die Verwertung von Bioabfällen, die als Futtermittel für omnivore Insekten, wie die schwarze Soldatenfliegenlarve (Hermetia illucens) dienen. Durch die darauffolgende Aufarbeitung der Larven können Protein-, Fett- und Chitinfraktionen gewonnen werden. Diese Fraktionen können in technischen Produkten Anwendung finden, wie bioabbaubaren Proteinfolien, Fettalkoholen oder Tensiden und Chitosan für Textilausrüstungen. Insekten werden laut der EU-Verordnung (1069/2009) als Nutztiere eingestuft. Um die Insekteninhaltsstoffe in den Nährstoffkreislauf zu bringen, sind nur Reststoffe als Futtersubstrat einsetzbar, welche als Futtermittel zugelassen sind und keine Fleischbestandteile beinhalten. Mit dem Projekt wurden die Grundlagen für eine dauerhaft angelegte Insektenbioraffiniere (InBiRa) geschaffen.
Zum Reallabor

Digitales Testfeld auf der Bundeswasserstraße Schlei
Das Reallabor Digitales Testfeld auf der Bundeswasserstraße Schlei erprobt seit 2021 autonome, vollelektrische und wasserstoffbasierte Systeme unter realen Bedingungen. Die Schlei verbindet Binnengewässer mit Küste und Offshore – ein ideales Umfeld für multimodale Tests. Das Reallabor ist damit das größte in Europa für maritime autonome Systeme und setzt internationale Maßstäbe. 2021 wurde hier das weltweit erste vollständig autonome Boot mit internationaler Zulassung und global gültiger Versicherung öffentlich vorgestellt – ein Meilenstein für Technologie und Regulierung. Erprobt werden sichere Integration in Verkehrsflüsse, Objekterkennung, V2X-Kommunikation, digitale Infrastruktur, dynamische Missionssteuerung und hybride Antriebssysteme (Elektro und Wasserstoff). Das Reallabor legte den Grundstein mit dem Fokus auf sichere Autonomie. Stefanie Engelhard validierte mit ihrem Team reale Anwendungen für automatisiertes Fahren auf dem Wasser und führt diese Entwicklung iterativ weiter. Diana Engelhard entwickelte das Digitale Testfeld und Reallabor weiter und brachte den strategischen Layer integrierter Systeme, integrierte Sicherheit, taktische KI und Dual-Use bereits seit 2021 konsequent ein. Beide prägten den Aufbau und die Vision des Reallabors gleichwertig. Das Reallabor dient als Blaupause für internationale Standards und erlaubt Test, Betrieb und Weiterentwicklung autonomer maritimer Systeme – ziviler wie sicherheitskritischer Natur.
Zum Reallabor

Einrichtung eines U-Space Reallabors in Hamburg
Droniq und die Deutsche Flugsicherung (DFS) entwickeln das Drohnenverkehrssystem der Zukunft: Im April 2021 hat die Europäische Kommission die Durchführungsverordnung 2021/664 zu U-Space beschlossen, die von den Mitgliedstaaten bis Januar 2023 in nationales Recht zu überführen war. U-Space stellt ein räumlich definiertes geografisches Gebiet dar, in dem unbemannte und bemannte Luftfahrt gemeinsam stattfinden und der Einsatz von Drohnen erleichtert und gefördert werden sollen. Hierzu gelten bestimmte Regeln und besondere Verantwortlichkeiten. Mit dem Reallabor wurde das U-Space Konzept erstmals in die Praxis übertragen. Dazu haben Droniq und die DFS von Mai bis November 2021 in Hamburg das U-Space Reallabor errichtet. Dieses sollte als Blaupause für die Implementierung von U-Spaces in Deutschland und Europa dienen. Förderer und Zuwendungsgeber war das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das Vorhaben umfasste die Konzeption, den luftrechtlichen Aufbau und die praktische Demonstration des gesamten U-Space Ökosystems. Zentrale Teilaspekte waren: Überführung der Verordnung in ein vollständiges Rollen- und Prozessmodell, welches auch Verfahren zur Organisation des Luftraums umfasst Entwicklung der erforderlichen technischen Funktionalitäten Errichtung des U-Space Reallabors im Hamburger Hafen Durchführung von Test- und Demoflügen Durchführung von Flugwochen für Drittunternehmen
Zum Reallabor

CampUS hoch i
Im Reallabor CampUS hoch i – und in seiner Fortsetzung unter dem Namen EKUS hoch i – geht es um die Umsetzung von Klimaneutralität im Gebäudebereich mit intelligenten Technologien. Dies wird auch deshalb angestrebt, da Gebäude im öffentlichen Sektor häufig zu wenig "Kümmerer" haben, die sich dem Ziel von Klimaneutralität verpflichten. Intelligente Technologien wie zum Beispiel prädiktive Regelungen der Heizung oder von Stromverbrauchern können hier helfen. Im Reallabor werden intelligente Techniken an Beispielgebäuden ausprobiert und besonders auch mit den Nutzenden und Stakeholdern diskutiert und gemeinsam weiter entwickelt. Fortschritte werden in einem Klimamonitoring ("Klimabarometer") dokumentiert und beispielhafte Lösungen in einer modernen Form der "Bauhütte" anschaulich präsentiert. Das Reallabor nimmt aber auch die Planungsphase und den Materialbedarf ("graue Energie") von öffentlichen Gebäuden in den Blick und wirbt für nachhaltige und klimaschonende Lösungen. Insgesamt werden technisch und menschlich intelligente Lösungen ("hoch i") adressiert.
Zum Reallabor

Digitalstadt Ahaus
Seit 1986 dient das westfälische Ahaus als Reallabor für innovative Entwicklungen. Hier wird geforscht und entwickelt, vor allem aber in der Praxis getestet, welche Dinge wie funktionieren. Die vernetzten Anwendungen verbinden dabei die reale mit der logischen Welt und machen die Stadt Smartphone-kompatibel. Durch die Anwendungen bieten sich in Ahaus hervorragende Möglichkeiten, um sich vor dem boomenden Onlinehandel, den expandierenden Flächenmärkten und auch den nahe gelegene Metropolzentren zu schützen. Eine übergreifende Super-App, KI gestützte Agents, Stadtportale zur Bürgerinformation, digitale Stadtgutscheine für die Kaufkraftbindung, aber auch Sharing-Modelle und Crowdbasierte Anwendungen für die Mobilität oder das Leben im Allgemeinen gehören dazu. Ebenso wie eine Reihe von Showcases wie smarte Hotels ohne Personal, ein 24-Stunden-Supermarkt zur Nahversorgung, eine begehbare Online-Plattform, Restaurants ohne Küche und viele bargeldlose, digitale Gastronomie-Angebote. Diese Beispiele und viele mehr sind auf dem offenen und freien Cloudbasierten Betriebssystem "chayns" entstanden und seit vielen Jahren oder erst seit einigen Monaten im Reallabor Ahaus im Einsatz.
Zum Reallabor
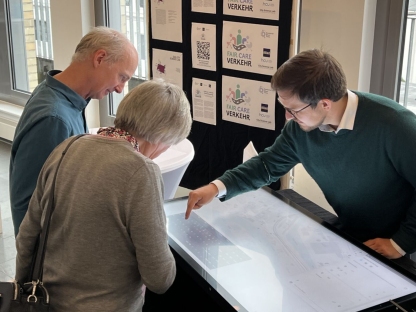
Reallabor Hamburg des Smart City Modellprojekts Connected Urban Twins
Unter Federführung des City Science Labs der HafenCity Universität Hamburg werden digitale Prototypen zusammen mit der Verwaltung und zivilgesellschaftlichen Akteuren entwickelt, getestet und als Tools in die modulare Architektur des digitalen urbanen Zwillings der Stadt Hamburg implementiert. Im Vordergrund stehen digitale Tools zur stärkeren Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in die Stadtplanung, zur Modellierung von komplexen urbanen Prozessen sowie zur Simulation von Was-wäre-wenn Szenarien im Kontext städtischer Entwicklungen. In diesem Zuge wird praxisorientiertes Wissen gewonnen, wie mittels digitaler Tools und urbanen Zwillingen die nachhaltige Entwicklung von Städten unterstützt und vorangetrieben werden kann. Das Reallabor ist Teil der Maßnahme "Transformative experimentelle Stadtforschung" im vom BMWSB geförderten Projekt Connected Urban Twins.
Zum Reallabor

Smart East Karlsruhe
Das Reallabor Smart East transformiert seit 2021 das Gewerbequartier Smart East in der Oststadt von Karlsruhe zu einem smarten, energieoptimierten, klimaschonenden Quartier. Die Bestandsgebäude wurden mit Smart Metern digitalisiert und in einem Quartiers-Energiemanagement vernetzt. Neue Geschäftsmodelle rund um Photovoltaik, Mieterstrom und Flexibilitätsmanagement werden entwickelt, unter realen Bedingungen erprobt und auf Wirtschaftlichkeit geprüft. Der Leuchtturm Smart East setzt so neue Maßstäbe für nachhaltigen, städtischen Klimaschutz und ist Vorbild für die wirtschaftliche Energiewende in der Stadt. Smart East ist heute Plattform für Klimaschutz, Showroom für innovative Lösungen und Testfeld für smarte Quartiere. Hier werden innovative Forschungskonzepte des KIT Karlsruher Institut für Technologie, FZI Forschungszentrum Informatik und der Hochschule Karlsruhe in der Praxis getestet – zusammen mit den Stadtwerken Karlsruhe und ihrer Tochter, der Badischen Energie Servicegesellschaft, den beiden Start-ups Solarize und InnoCharge und dem Energie-IT-Spezialisten Seven2one. Smart East wird seit dem 17.10.2023 im Rahmen des EU-Projekts "WeForming" zum Netzstabilisator weiterentwickelt. Dabei geht es um die Themen Stationäre Batteriespeicher im Quartier netzdienlich betreiben Bidirektionales Laden von E-Fahrzeugen mit netzdienlicher Rückspeisung Dynamische Stromtarife Green Carsharing Sektorkopplung Optimierte Wärmeversorgung, zum Beispiel mit Wärmepumpen
Zum Reallabor

Erprobung des humanoiden Roboters Pepper im Welcome-Bereich der Tourist-Info Bremerhaven
In dem als Reallabor eingerichteten "Maschinenraum" wurde der humanoide Roboter "Pepper" für seinen Einsatz im Welcome-Bereich der Tourist-Info Bremerhaven erprobt. Für die Umsetzung des Forschungsprojekts hat die städtische Tourismusgesellschaft Erlebnis Bremerhaven (EBG) mit der Hochschule Bremerhaven kooperiert und wurde durch das Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft unterstützt. Projektziel war, die KI des Roboters hinsichtlich der Interaktionsfähigkeiten zu optimieren sowie die Kundenorientierung zu verbessern. Zentrale Funktionen wie Dialog oder emotionale Intelligenz wurden gemeinsam mit interessierten Besucherinnen und Besuchern getestet. Ganz konkret wurden Funktionen aus dem Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz, Gesichtserkennung sowie Spracherkennung in dem "Maschinenraum" entwickelt und erprobt. Ergänzend dazu wurden dem Roboter verschiedene Sprachen implementiert und für die manuelle Steuerung eine Steuerungs- und Sprach-App entwickelt. Durch die laufende Rückkopplung und Erprobung der Funktionen mit der Stadtgesellschaft im "Maschinenraum" wurden Funktionalität, Usability und zielgruppenorientierte Ansprache des Roboters trainiert und optimiert sowie die Teilhabe der Öffentlichkeit an dem Projekt ermöglicht.
Zum Reallabor
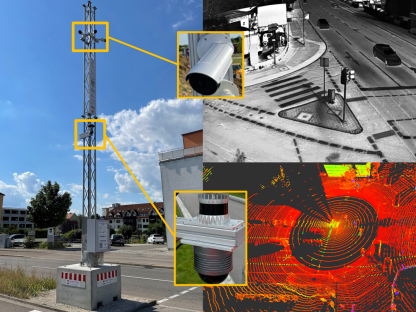
High Definition Testfeld
Im High Definition Testfeld (HDT) wird unter realen städtischen Bedingungen erprobt, wie hochpräzise Sensortechnik, künstliche Intelligenz und intelligente Vernetzung die Grundlage für ein leistungsfähiges, sicheres und ressourcenschonendes Verkehrssystem der Zukunft schaffen können. An drei stark frequentierten innerstädtischen Kreuzungen in Ingolstadt wurden dafür an insgesamt sieben Standorten stationäre Überkopf-Sensoren mit LiDAR-Technologie und hochauflösenden Kameras installiert. Diese erfassen Verkehrsteilnehmer wie Kraftfahrzeuge, Radfahrende und Fußgänger in sicherheitskritischer Echtzeit, lokalisieren sie und bewerten die Verkehrslage. Die gewonnenen Informationen bilden die Basis für innovative Anwendungen wie adaptive Ampelsteuerungen oder intelligente Frühwarnsysteme, die kritische Situationen frühzeitig erkennen und gezielte Schutzmaßnahmen wie Warnhinweise ermöglichen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf der kooperativen Vernetzung zwischen Infrastruktur, Fahrzeugen und Radfahrern. Durch den Austausch von Informationen und die aktive Beteiligung an automatisierten Sicherheitsfunktionen soll intelligente Infrastruktur zukünftig die Grundlage für ein fehlertolerantes Verkehrssystem werden.
Zum Reallabor

Reallabor für den automatisierten Busbetrieb im ÖPNV in der Stadt und auf dem Land – RABus
Im Reallabor RABus wird die Integration hochautomatisierter Shuttles in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unter realen Bedingungen erprobt – sowohl im urbanen als auch im ländlichen Raum. Die technologische Innovation liegt in der Nutzung von Fahrzeugen mit automatisierter Fahrfunktion nach § 1i StVG, die über eine Erprobungsgenehmigung auf Basis der AFGBV in einem rechtlich geschützten Testumfeld zugelassen wurden. Diese Genehmigung dient als eine Art Experimentierklausel, um automatisierte Mobilitätslösungen unter praxisnahen Bedingungen zu testen. Erprobt wird dabei nicht nur das Fahrzeug selbst, sondern das komplexe Zusammenspiel aus Technik, Betrieb, Ladeinfrastruktur, Leitstellenanbindung, Fahrgastkommunikation und digitalem Buchungssystem. Zusätzlich fließen Aspekte wie Barrierefreiheit, Nutzerakzeptanz und die verkehrliche Wirkung in die Bewertung ein. Ziel ist es, automatisierte Shuttles als Ergänzung im ÖPNV – insbesondere auf der ersten und letzten Meile – zu bewerten und Impulse für zukünftige Regelanwendungen zu schaffen.
Zum Reallabor

a-BUS Iserlohn - New Mobility Lab
Im Reallabor a-BUS Iserlohn - New Mobility Lab wurde das perspektivisch autonome Fahren im ÖPNV anwendungsorientiert umgesetzt und mit wissenschaftlicher Begleitung erforscht, um eine Übertragbarkeit auf ähnlich gelagerte Anwendungsfälle zu eröffnen. Ziel des Projektes war es, am Beispiel der Anbindung des Hochschulcampus Iserlohn an die öffentlichen Verkehrssysteme das automatisierte Fahren mit Level 4, d. h. den vollautomatischen Betrieb, im ÖPNV anwendungsorientiert zu erforschen und dabei grundlegende Erkenntnisse zum Potenzial perspektivisch autonom fahrender Systeme als wirtschaftliche Lösung für "die letzte Meile" zu gewinnen. Hierbei handelte es sich um ein spezifisches Mobilitätsangebot für den ländlichen Raum sowie eine Quartierslösung. Hierdurch war ein rudimentärer Einstieg in "neue und innovative" Mobilitätsformen gegeben. Der Test wurde auf einer ca. 1,5 Kilometer langen Strecke zwischen dem Stadtbahnhof Iserlohn und dem Hochschulcampus Iserlohn mit zwei voll automatisieren Kleinbussen durchgeführt. Hierzu wurde ein auf deutschen Straßen bereits zugelassenes, automatisiertes Bussystem mit batterieelektrischem Antrieb eingesetzt.
Zum Reallabor

Recyclinganlage für Inhalte aus Trockentoiletten
Im Reallabor im Landkreis Barnim wird von den Unternehmen Finizio GmbH, VunaNexus AG und der Kreiswerke Barnim GmbH demonstriert und erforscht, wie menschliche Ausscheidungen aus Trockentoiletten nachhaltig verwertet werden können. Anstatt diese ungenutzt zu entsorgen, werden sie zu qualitätsgesicherten Recyclingdüngern verarbeitet: Qualitätskompost zur Bodenverbesserung und Mehrnährstoffflüssigdünger, der wichtige Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor enthält. Das Ziel ist es, eine umweltfreundliche, gesellschaftlich akzeptierte, wirtschaftlich sinnvolle und rechtlich klar geregelte Lösung im Abfall- und Düngemittelregime zu entwickeln. Dazu werden Hygienestandards, Schadstofffreiheit und die landwirtschaftliche Wirkung untersucht. Gleichzeitig werden rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen geprüft und Methoden erarbeitet, um das System auf andere Kommunen zu übertragen. Durch enge Zusammenarbeit mit Gemeinden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zeigt das Reallabor, wie Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktionieren kann – für eine resiliente Landwirtschaft und den Schutz natürlicher Ressourcen.
Zum Reallabor

Smart City Campus Westhausen
Der Smart City Campus des Zentrums für Digitale Entwicklung (ZDE), von KI-P GmbH und GEO DATA GmbH in Westhausen fungiert als wissenschaftlich fundiertes Reallabor für kommunale Anwendungen. Er bietet eine praxisnahe Umgebung, in der innovative Technologien unter realen Bedingungen erprobt und weiterentwickelt werden können. Durch die Integration von Sensorik, Datenverarbeitung und -visualisierung ermöglicht der Campus eine umfassende Analyse und Optimierung städtischer Prozesse. Ein zentrales Merkmal des Campus ist die modulare Infrastruktur, die verschiedene Anwendungen wie intelligentes Parkraummanagement, Umweltüberwachung und öffentliche Sicherheit umfasst. Beispielsweise werden bodensensorbasierte Parksysteme, Glatteiserkennung und Luftqualitätsmessungen in Echtzeit durchgeführt. Diese Technologien sind in intelligente Leuchten integriert, die zusätzlich als Träger für 5G-Picozellen und öffentliche WLAN-Hotspots dienen. Der Campus agiert als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und kommunaler Praxis. Durch die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren können Lösungen entwickelt werden, die sowohl technologisch fortschrittlich als auch auf die spezifischen Bedürfnisse von Kommunen zugeschnitten sind. Dies fördert die Entwicklung nachhaltiger und lebenswerter Städte.
Zum Reallabor
BML Ecosys – Bauhaus.MobilityLab Erfurt
Das Reallabor Bauhaus.MobilityLab hat umwelt- und gemeinwohlorientierte Mobilitätslösungen durch KI-basierte Dienstleistungen entwickelt. Es testete die automatisierte Erkennung der Verkehrsmittelwahl mittels maschinellen Lernens und datenschutzkonforme Belohnungssysteme durch Federated Learning. In Erfurt wurde die Verkehrstechnik mit KI-Sensorik ausgestattet, um stadtweite Luftqualitätsmodelle zu erproben und in ein umweltfreundliches Verkehrsmanagement zu integrieren. Verkehrsampeln wurden mit KI-Schaltzeitprognosen optimiert, und intelligente Kamerasysteme zur Fahrzeugerkennung eingesetzt. Im Energiemanagement wurde der lokale Energiebedarf durch KI besser abgestimmt. Ferner wurden Mieterstromkonzepte getestet, bei denen lokal erzeugter Strom optimal genutzt wird, und Methoden zur Automatisierung des Energiemanagements entwickelt. Im Logistiksektor hat das Reallabor die Supply Chain optimiert, insbesondere bei Paketzustellungen mit elektrischen Fahrzeugen. Ein digitaler Zwilling der Stadt hat Szenarien bewertet, zudem wurden innovative Zustellfahrzeuge sowie hochautomatisiertes Fahren getestet.
Zum Reallabor
NPM AG 3 Reallabor Digitale Mobilität (RealLabHH)
Im Reallabor Hamburg (RealLabHH) wurde die Mobilität von morgen im Hier und Jetzt einer Metropole erprobt und darauf aufbauend ein Leitfaden für die digitale Mobilität der Zukunft erstellt. Die gesellschaftliche Debatte zu digitalen Mobilitätsservices stand dabei im Zentrum, um wichtige Erkenntnisse darüber zu liefern, welche Ansätze sich in der Praxis bewähren. Die zehn Teilprojekte des RealLabHH reichten vom Mobilitätsbudget anstelle eines Dienstwagens über die Schaffung einer anbieterunabhängigen Mobilitätsplattform bis hin zu Lösungen für besonders schutzbedürftige Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr: Mobilitätsplattform Dateninteraktion und -souveränität Mobilitätsbudget Autonomes Fahren (öffentlich) On-Demand im ländlichen Raum Warentransport Mikrodepot Vernetzte Vulnerable Road Users (VRUs) Digitales Andreaskreuz Dialogstrategie Servicedesign und Simulation Die gewonnenen praktischen Erkenntnisse konnten mithilfe von Modellierung und Simulation verschiedener Verkehrs- und Umweltwirkungen der im Projekt demonstrierten Technologien quantifiziert und skaliert werden.
Zum Reallabor

NUDAFA-Reallabor für interkommunale Radverkehrsförderung
In den Gemeinden Eichwalde, Zeuthen und Schulzendorf spielt das Fahrrad eine zentrale Rolle im Alltag der Menschen. Dennoch fehlte bisher eine koordinierte Strategie zur Förderung des Radverkehrs. Genau hier setzt das NUDAFA-Reallabor an: Unter dem Motto "Radverkehrsplanung beschleunigen. Gemeinsam, digital und praxisnah" erforscht es innovative Ansätze für die Radverkehrsplanung in kleinen Kommunen und interkommunale Kooperationen. Ein zentrales Element ist das "Interkommunale Radverkehrsmanagement", das eingerichtet und umfassend evaluiert wurde, um die Zusammenarbeit der Gemeinden zu verbessern. Ergänzend dazu wurden verschiedene Modellprojekte umgesetzt, darunter: die digitale Planungs- und Kommunikationsplattform "NUDAFA_Radverkehrsatlas" (zum Radnetz); ein 10 km langer interkommunaler Radweg, der vier Gemeinden verbindet; ein Pilotprojekt für modulares Fahrradparken, das flexible und platzsparende Lösungen für urbane Räume erprobt. Das Reallabor wird durch ein starkes Netzwerk getragen. Verbundpartner sind die Gemeinde Eichwalde, die Technische Universität Berlin, die Technische Hochschule Wildau und FixMyCity. Darüber hinaus engagieren sich als Partnerkommunen die Gemeinden Zeuthen, Schulzendorf und Schönefeld sowie die Städte Wildau und Königs Wusterhausen.
Zum Reallabor

KI4LSA - Optimierung des Verkehrsflusses durch KI-gesteuerte Ampeln (LSA - Lichtsignalanlagen)
Der zunehmende innerstädtische Verkehr führt zu Umweltbelastungen, hohen Reisezeiten und erhöhtem Treibstoffverbrauch für die Verkehrsteilnehmer. Ein wesentlicher Hebel zur Verbesserung des Verkehrsflusses im innerstädtischen Bereich liegt in der Optimierung der Steuerungen von Lichtsignalanlagen (LSA). Ziel des Projektes "KI4LSA" war es daher, mittels Reinforcement Learning (RL) – einem Verfahren der Künstlichen Intelligenz – die LSA so zu steuern, dass der Verkehrsfluss optimiert wird. Zu diesem Zweck wurde die KI in einer Simulation trainiert und anschließend ausgewertet. Des Weiteren wurde das System auch im Realbetrieb erprobt, wozu eine Testkreuzung mit zusätzlicher Hardware und Sensorik nachgerüstet wurde. Im Projekt "KI4LSA" wurde weltweit das erste Mal eine RL-basierte LSA-Steuerung erfolgreich im Realbetrieb eingesetzt. Hierzu wurde zunächst ein Softwareframework zum Trainieren des RL-Algorithmus entwickelt. Der trainierte RL-Agent wurde anschließend zur Steuerung einer realen LSA eingesetzt. Hierzu wurden zusätzliche Kamera- und Radarsensoren an der Kreuzung installiert, die eine spurgetreue Erfassung der Verkehrssituation in Echtzeit ermöglichten und als Entscheidungsgrundlage für den RL-Agent dienen. Im Realbetrieb konnte so die durchschnittliche Reisezeit von Fahrzeugen um ca. 10 % reduziert werden. Des Weiteren konnte in der Simulation eine Emissionsreduktion von 15-20 % nachgewiesen werden.
Zum Reallabor

Medifly Hamburg (Phase 1)
In Phase 1 des Projekts Medifly wurde die grundsätzliche Machbarkeit von Drohnenflügen in der Stadt und in der Kontrollzone eines Flughafens zum Zweck des Transports medizinischer Güter getestet. Neben der technischen Ausstattung des Fluggeräts musste geklärt werden, wer zu welcher Zeit über die stattfindenden Flüge informiert werden musste und wie eine Einbindung in die Krankenhausprozesse erfolgen kann. Die Drohne flog die Strecke von etwa 5 km automatisiert. Entlang der Flugroute wurden Streckenposten positioniert, sodass das Fluggerät zu jeder Zeit in Sicht eines Steuerers war, der im Notfall in den Flug hätte eingreifen können, zum Beispiel um anderen Luftverkehr nicht zu gefährden. Die Machbarkeitsstudie war eine Auflage der Landesluftfahrtbehörde und diente als eine Vorstufe für künftige Flüge außer Sicht des Steuers.
Zum Reallabor

MONOCAB System
Ein Problem bei der Anbindung ländlicher Räume an den öffentlichen Verkehr: Einige Bahnstrecken sind nur eingleisig befahrbar. Dadurch können die Züge nur in geringer Taktung verkehren. "MONOCABs" sind kompakt und schmal und können auf nur einer Schiene fahren. Der große Vorteil der kleinen Kabinen: Auf eingleisigen Bahnstrecken könnten zwei autonom fahrende "MONOCABs" gleichzeitig in beide Richtungen fahren und so den Personenverkehr auf der Schiene vor allem im ländlichen Raum stärken. Während der Fahrt sorgt ein Kreiselsystem für die Stabilität und das Gleichgewicht der sehr schmalen Fahrzeuge, die auf Abruf - on demand - gebucht werden sollen. Ziel ist es, die Anbindung ländlicher Räume an Ober- und Mittelzentren zu verbessern und Menschen ohne eigenes Auto die Mobilität zu erleichtern. Die TH OWL, die Hochschule Bielefeld und das Fraunhofer IOSB INA in Lemgo haben die Machbarkeit des Fahrzeugkonzepts nachgewiesen. Ziel des Reallabors ist es, erste autonome Versuchsfahrzeuge auf einer Teststrecke fahren zu lassen, um später einen Test-Regelbetrieb auf den Strecken in Nordlippe zu realisieren. Die Lösung soll in der Benutzung intuitiv und selbstverständlich sein und so in Zukunft zur individuellen Mobilität im ländlichen Raum beitragen. Die Idee wurde 2018 mit dem Deutschen Mobilitätspreis "Open Innovation" ausgezeichnet.
Zum Reallabor

Ride4All-Entwicklung eines integrierten und inklusiven Verkehrssystems für autonom fahrende Busse
Die Besonderheit ergibt sich bereits aus dem Projektnamen: Ride4All bzw. Fahren für alle lässt schnell erahnen, dass es hier nicht nur um das Thema autonomes Fahren geht. Im Mittelpunkt des Forschungs- und Entwicklungsprojektes standen die Fragen "Kann ein autonomes Shuttle heute schon von allen Menschen ohne Einschränkungen genutzt werden?" und "Wie muss das Verkehrssystem der Zukunft gestaltet sein, damit niemand ausgeschlossen wird?". "Alle Menschen" bezieht sich schwerpunktmäßig auf mobilitäts- und sinneseingeschränkte Menschen und folgt der Überzeugung, dass Entwicklungen für mobilitäts- und sinneseingeschränkte Menschen einen Mehrwert für jedermann bilden. Um die Forschung unter Realbedingungen durchzuführen, wurde der Shuttle SOfia (SOest fährt inklusiv & autonom) in den Regelbetrieb des ÖV-Netzes der Regionalverkehr Ruhr-Lippe integriert und war damit Bestandteil des Straßenverkehrs in Soest. Zum Projektkonsortium gehörten der Kreis Soest, die Stadt Soest, die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, das LWL-Berufsbildungswerk Soest, die GeoMobile GmbH, das Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOCUS) und die eagle eye technologies GmbH. Die Forschungsergebnisse des Projektes stehen im "Konzept zur Barrierefreiheit und sozialen Akzeptanz von autonom fahrenden Bussen" zur Verfügung.
Zum Reallabor

Gute Küste Niedersachsen - Reallabor Butjadingen
Im Rahmen des Reallabors konnten alle Besuchenden des Naturlehrpfads im Langwarder Groden mit ihren Mobiltelefonen die natürliche und dynamische Entwicklung der renaturierten Salzwiese und der Wattpriele aufnehmen. Die wachsende Datensammlung wird nach Projektabschluss durch die Nationalparkverwaltung weitergeführt. Auf dem Sommerdeich des Grodens findet man außerdem auch nach Abschluss der Messungen noch die Versuchsflächen mit alternativen Saatenmischungen: Hier wurde untersucht, ob auch biodiverse Vegetationen die gleiche Stabilität der Deichkrone wie die derzeit üblichen Gräser bieten können. Unter der Leitfrage "Was ist eine Gute Küste für heute und die Zukunft?" beschäftigten sich von 2020 bis 2024 knapp 30 Forschende der Universitäten Braunschweig, Oldenburg und Hannover im interdisziplinären Verbundprojekt "Gute Küste Niedersachsen" u. a. in 3 Reallaboren – Butjadingen, Neßmersiel und Spiekeroog. Parallel zum Reallaborprozess erfolgte eine begleitende Evaluierung, welche die Eignung und Wirksamkeit der aufgebauten Strukturen für das Erreichen der Projektziele analysiert. Die Ergebnisse dienen u. a. dazu, Empfehlungen für künftige Reallabore im Küstenschutz abzuleiten.
Zum Reallabor

Gute Küste Niedersachsen - Reallabor Spiekeroog
Auf Spiekeroog wurden in den Dünen und Salzwiesen umfangreiche Feldmessungen durchgeführt und Proben gesammelt, um die Leistungen dieser Ökosysteme für den Küstenschutz besser zu verstehen. Dabei wurde z. B. jeden Monat die Biegesteifigkeit der Pflanzen gemessen und mechanischen Tests unterzogen. Außerdem wurde erforscht, welche Rolle der Strandhafer mit seinen Terrassenwurzeln beim Anwachsen der Dünen spielt und wie er ihre Stabilität bei Sturmfluten erhöht. Dazu wurden die Seegatten im Westen und Osten der Insel mit Forschungsschiffen befahren und die Umweltbedingungen mit zahlreichen Messdaten und Proben erfasst. Da aus Sicherheitsgründen keine Erprobungen an intakten Küstenschutzvorrichtungen realisiert werden konnten, wurden Labortests im Naturmaßstab durchgeführt, in denen genaue Modelle im Wellenkanal und in Simulationen ihre dämpfende Wirkung auf Wellen und Strömungen zeigen konnten. Darüber hinaus wurden Interviews mit Stakeholdern, Touristen und der Nationalparkverwaltung geführt. Unter der Leitfrage "Was ist eine Gute Küste für heute und die Zukunft?" beschäftigten sich von 2020 bis 2024 knapp 30 Forschende der Universitäten Braunschweig, Oldenburg und Hannover im interdisziplinären Verbundprojekt "Gute Küste Niedersachsen" u. a. in 3 Reallaboren – Butjadingen, Neßmersiel und Spiekeroog. Parallel zum Reallaborprozess erfolgte eine begleitende Evaluierung, welche die Eignung und Wirksamkeit der aufgebauten Strukturen für das Erreichen der Projektziele analysiert. Die Ergebnisse dienen u. a. dazu, Empfehlungen für künftige Reallabore im Küstenschutz abzuleiten.
Zum Reallabor

Gute Küste Niedersachsen - Reallabor Neßmersiel
Im Reallabor wurde das als Weidefläche genutzte Deichvorland im Zuge einer Ausgleichsmaßnahme abgegraben, damit sich wieder eine natürliche und artenreiche Salzwiese bilden kann. In diesem Zuge wurden Messungen im Wasser und am Boden durchgeführt und erforscht, wie viel CO2 dadurch gebunden werden kann und wie Salzwiesen dadurch beim Erreichen der Klimaziele helfen können. Außerdem wurde untersucht, wie die Deiche dadurch sicherer werden, weil die Erosion gestoppt wird und die Salzwiesen mit dem Meeresspiegel mitwachsen können. Ergänzend wurden 3D-Zukunftsbilder und Narrative für Neßmersiel und Spiekeroog erstellt, um integrierte Küstenschutzstrategien visuell erfahrbar zu machen und mit lokalen Akteurinnen und Akteuren zu diskutieren. Dabei flossen auch Erkenntnisse aus sozial-ökologischen Experimenten ein, welche die Wirkung, Akzeptanz und Umsetzung ökosystembasierter Maßnahmen untersuchten. Unter der Leitfrage "Was ist eine Gute Küste für heute und die Zukunft?" beschäftigten sich von 2020 bis 2024 knapp 30 Forschende der Universitäten Braunschweig, Oldenburg und Hannover im interdisziplinären Verbundprojekt "Gute Küste Niedersachsen" u. a. in 3 Reallaboren – Butjadingen, Neßmersiel und Spiekeroog. Parallel zum Reallaborprozess erfolgte eine begleitende Evaluierung, welche die Eignung und Wirksamkeit der aufgebauten Strukturen für das Erreichen der Projektziele analysiert. Die Ergebnisse dienen u. a. dazu, Empfehlungen für künftige Reallabore im Küstenschutz abzuleiten.
Zum Reallabor

Zentrum für Produktion der Zukunft / Centre for Future Production (CFP)
Das Zentrum für Produktion der Zukunft (CFP) erprobt als zentraler Akteur des KI-Produktionsnetzwerks Augsburg die Integration von Künstlicher Intelligenz in reale Produktionsumgebungen. Im Mittelpunkt stehen die KI-gestützte Regelung und Steuerung von Maschinen, Anlagen und komplexen Produktionsabläufen, ergänzt durch den Einsatz von Assistenzsystemen, die die Interaktion zwischen Mensch und Maschine optimieren. Die KI-Systeme, die von den Forschenden entwickelt werden, können mit Anlagen im industriellen Realmaßstab getestet werden. Umgekehrt werden diese Anlagen auch dazu genutzt, Daten für KI-Modelle mit realistischer Komplexität zu generieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der menschzentrierten Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben, insbesondere der DSGVO. Darüber hinaus entwickelt das CFP Bildungsprogramme, die KI-Kompetenz für Unternehmen zugänglich machen, und setzt dabei auf die Expertise der 26 beteiligten Professoren und Professorinnen der Universität Augsburg.
Zum Reallabor

SOLAR.shell Transfer - Entwicklung, Realisierung und Validierung einer SOLAR.shell-Prototypfassade
SOLAR.shell Transfer erprobt eine innovative, architektonisch ansprechende Photovoltaik-Fassade unter realen Bedingungen. Ziel ist es, die Energiewende aktiv in die Gestaltung der gebauten Umwelt zu integrieren. Im Reallabor wird die technische und gestalterische Integration kleinformatiger PV-Module in dreidimensionale Fassadenelemente getestet. Diese werden mittels parametrisch-generativer Computerberechnungen optimal zur Sonne ausgerichtet und verleihen jeder Fassade eine individuelle Erscheinung. Der Ertrag pro Quadratmeter PV-Fläche konnte so um bis zu 55 % gegenüber planaren Modulen gesteigert werden. Ein ca. 300 m² großer Prototyp wurde an einem gewerblichen Neubau montiert und wird über ein Monitoring evaluiert. Neben der solaren Ertragssteigerung stehen die technische Machbarkeit und wirtschaftliche Skalierbarkeit im Fokus. Einbringung und Befestigung der Photovoltaik-Module wurden über Bauteilversuche getestet und mit besonderen Fachgutachten baulich zugelassen. Das Projekt endete offiziell am 30.06.2022. Die Fassade ist jedoch weiterhin in Betrieb. Erträge, Funktionsprüfungen und Wartung werden seitdem vom Eigentümer fortgeführt und regelmäßig dokumentiert. Damit ist das projektbezogene Monitoring abgeschlossen, der laufende Betrieb liegt beim Eigentümer.
Zum Reallabor
Blockchain für notarielle Vollmachten und Erbscheine ─ Das Blockchain-basierte Gültigkeitsregister
Die Blockchain-Technologie ist in aller Munde. In der deutschen Justiz ist sie bisher jedoch kaum aktiv zum Einsatz gekommen. Mit diesem Reallabor wurde der Einsatz erstmals erprobt. Dazu haben die Bundesnotarkammer, das Bayerische Staatsministerium der Justiz und das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT innerhalb von drei Monaten ein Blockchain-basiertes Gültigkeitsregister erfolgreich in München, Berlin und Bayreuth aufgebaut und getestet. Das neue Gültigkeitsregister soll notarielle Vollmachten und Erbscheine in die elektronische Welt überführen. Viele Abläufe können dadurch zum Vorteil der Bürger, Notare und Gerichte deutlich vereinfacht und beschleunigt werden. Über 500 getestete Transaktionen auf vier Blockchain-Knoten haben die technische Lösung bestätigt. Die Machbarkeitsstudie des Fraunhofer-Instituts FIT lieferte ebenfalls positive Ergebnisse, benannte jedoch noch offene Fragestellungen, die im Follow-up-Prozess behandelt werden, wie etwa die Ergänzung des § 47 BeurkG um "elektronische Ausfertigungen". Aufbauend auch auf den wichtigen technischen, fachlichen und wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem beschriebenen Reallabor treibt die Bundesnotarkammer nun konkret den Aufbau eines Vollmachtsregisters voran.
Zum Reallabor
5G4Healthcare
Das Projekt 5G4Healthcare, in dem die Potenziale und Möglichkeiten der 5G-Technologie für das Gesundheitswesen erforscht wurden, wurde am Gesundheits- und Medizintechnikcampus in Weiden durchgeführt. Ziel des Projektes war es, die Machbarkeit, die Möglichkeiten sowie die Grenzen der Verbesserung der Effektivität und Effizienz in der Gesundheitsversorgung durch die 5G-Technologie auszuloten und Handlungsempfehlungen für skalierbare Lösungen abzuleiten. Während der Projektlaufzeit entstanden bei ambulanten und stationären Partnern der regionalen Gesundheitsversorgung sogenannte Living Labs. In diesen praxisnahen Testumgebungen wurden Nutzen und Möglichkeiten der 5G-Technologie für digitale Lösungen erprobt und bewertet. Der Einsatz von 5G wurde in ausgewählten Use Cases und Schwerpunktthemen wie Healthcare-Logistik, Automatisierung und Robotik konzipiert, modellhaft implementiert und evaluiert. Dafür wurden die Szenarien zunächst in einem Test Bed entwickelt und einer ausführlichen Ist-Analyse unterzogen.Die zweite Phase des Vorhabens, die "Implementierung" fokussierte sich auf die Umsetzung der Konzeption. Dabei wurden mobile 5G-Einheiten (Campus Netze) in weiteren Living Labs installiert, um die Szenarien in realen Umgebungen durchzuführen. Die letzte Phase "Evaluation" beschäftigte sich mit der Auswertung der durchgeführten Szenarien. Darüber hinaus wurde ein Verwertungs- und Verstetigungskonzept abgeleitet.
Zum Reallabor

Landnetz
Von 2019 bis 2024 hat das Experimentierfeld LANDNETZ Smart Farming Lösungen und Methoden zum effektiven, transparenten und sicheren Datenaustausch für die Landwirtschaft als grundlegende Bedingung für eine Landwirtschaft 4.0 entwickelt, konzipiert und getestet. Ziel war die Schaffung eines digitalen Experimentierfelds mit Fokus auf die erforderlichen Kommunikations- und Cloudinfrastrukturen zur drahtlosen Datenübertragung mit Hilfe von 5G. Im Zusammenspiel mit zahlreichen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern aus Landwirtschaft, Industrie sowie Verbänden und Vereinen wurden bis Sommer 2024 digitale Anwendungsfälle in der Tierhaltung, im Obst- und Weinbau sowie im Pflanzenbau konzipiert, erprobt und optimiert. Weiterhin wurde die sicherheitskritische Kommunikation an der Schnittstelle zwischen Pkw und Landmaschine untersucht. Neben der Erarbeitung eines Konzepts zum Wissenstransfer erfolgte unter anderem die Entwicklung von Betreiber- und Geschäftsmodellen für neue Wertschöpfungsketten.
Zum Reallabor

NUMIC - Neues urbanes Mobilitätsbewusstsein in Chemnitz
Im Projekt „NUMIC – Neues urbanes Mobilitätsbewusstsein in Chemnitz“ planten die Bürgerinnen und Bürger in den Jahren 2019 bis 2022 gemeinsam mit der Stadtverwaltung und der Wissenschaft – ganz im Sinne des Citizen-Science-Gedankens – ihre zukünftige Route für den Rad- und Fußverkehr. Über eine digitale Plattform, eine Mobilitäts-App sowie klassische Beteiligungsformate wurden Ideen, Erfahrungen und das Wissen der Bürgerschaft aktiv eingebracht – von der ersten Datenerhebung bis hin zur praktische Erprobung der Modellroute. Das Spektrum der Beteiligungen auf der Innovationsplattform reichte dabei von einfachen Abstimmungen über mehrteilige Ideeneinreichungen und Votings bis hin zu georeferenzierten Meldungen. So entstanden neue Formen der Zusammenarbeit und des Austauschs, bei denen die Menschen vor Ort eine echte Stimme im Planungsprozess erhielten. Die beschilderte Modellroute ist bis heute befahrbar. Ziel des Verbundprojekts war es, auf Grundlage der prototypisch und co-kreativ entwickelten Modellroute einen übertragbaren Ansatz für eine datenbasierte und partizipative Entwicklung urbaner Mobilitätslösungen zu schaffen – als Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung.
Zum Reallabor

Collegium Academicum Heidelberg
Das selbstverwaltete Wohnprojekt Collegium Academicum (CA) für junge Menschen, insbesondere für Studierende, Auszubildende und Menschen in einer Orientierungsphase nach der Schulzeit, entstand ab 2019 auf der militärischen Konversionsfläche „US-Hospital“ in Heidelberg. Eine der Ideen der studentischen Projektgruppe, die das Projekt auf den Weg gebracht hat, war es, mit dem CA einen Nukleus für ein neues, suffizienzorientiertes Stadtquartier zu schaffen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner wurde ein Ort für bezahlbares, an Nachhaltigkeit orientiertes und selbstbestimmtes Leben geschaffen, der Demokratie erlebbar macht sowie den kulturellen und sozialen Austausch in einem Bildungskontext fördert. Das Collegium Academcium war 2019-2025 eines von drei Reallaboren in den Projekten "SuPraStadt I und II - Lebensqualität, Teilhabe und Ressourcenschonung durch soziale Diffusion von Suffizienzpraktiken in Stadtquartiere". Forschungsziel war es, Suffizienz durch Formate zur sozialen Diffusion im Alltag der Bürgerinnen und Bürger sichtbarer, erfahrbarer und attraktiver zu machen. Dazu wurden Suffizienzpraktiken systematisch und wissenschaftlich fundiert identifiziert, transdisziplinär erprobt und hinsichtlich ihrer ökologischen und sozialen Wirkungen bewertet. Zur Verstetigung wurden für ausgewählte Suffizienzpraktiken Formate zur sozialen Diffusion entwickelt und als "Anleitungen zum Selbermachen" dokumentiert.
Zum Reallabor

ABSOLUT-Testfeld
Ziel von ABSOLUT ist die Entwicklung und Zusammenführung aller für eine ÖPNV-Gesamtlösung notwendigen Bestandteile aus Fahrzeug, Infrastruktur, Leitstelle, technischer Aufsicht und Kundenzugang. Im Leipziger Nordraum wurde das im ABSOLUT-Konsortium entwickelte hochautomatisierte Fahren zwischen Leipziger Messe und BMW Werk Group Leipzig auf einer eigens ertüchtigten Teststrecke erprobt. Im Anschlussprojekt ABSOLUT II wird nun der Fernzugriff auf das Fahrzeug über eine Manöverfreigabe von der Leitstelle aus entwickelt. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, künftig rein fahrerlose Fahrzeuge im ÖPNV ohne das derzeit noch vorgeschriebene Sicherheitsfahrpersonal betreiben zu können. Auf diese Weise können mehrere autonome Fahrzeuge durch eine sogenannte "Technische Aufsicht" von der Leitstelle aus zentral betreut werden. Perspektivisch soll die in den ABSOLUT-Projekten entwickelte Technologie mit dem von den Leipziger Verkehrsbetrieben bereits erfolgreich eingeführten On-Demand-System Flexa kombiniert werden. Dies ermöglicht erstmalig eine großflächige und gleichzeitig wirtschaftliche Erweiterung des ÖPNV in den Stadtrandgebieten sowie die Vernetzung mit dem bestehenden Hochleistungsnetz aus Bus und Bahn.
Zum Reallabor

Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg (TAF BW)
Das Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg ist ein Reallabor für Mobilitätskonzepte, das die Entwicklung zukunftsorientierter Lösungen für Individualverkehr und Öffentlichen Verkehr unterstützt. Firmen und Forschungseinrichtungen können ihre Technologien und Dienstleistungen rund um das vernetzte und automatisierte Fahren erproben – auf mit Sensorik und Vernetzungstechnologien (V2X) ausgebauten Referenzstrecken im Alltagsverkehr und einem Testgelände. Von automatisierten Autos und Bussen über Nutz- und Sonderfahrzeuge wie Straßenreinigung und Einsatzfahrzeuge bis zu Zustelldiensten können auf dem Testfeld verschiedenste Mobilitätskonzepte und -lösungen erprobt werden. Das im Mai 2018 in Betrieb genommene Testfeld umfasst im Unterschied zu anderen Projekten alle Arten von öffentlichen Straßen: Autobahnabschnitte, Landes- und Bundesstraßen, innerstädtische Routen mit Rad-, Fußgänger- und Straßenbahnverkehr ebenso Tempo-30-Zonen, Wohngebiete und Parkhäuser. Die Testfeldstrecken befinden sich in Karlsruhe, Bruchsal und Heilbronn. Betrieben wird das Testfeld vom Karlsruher Verkehrsverbund, Koordinator des technischen Aufbaus ist das FZI Forschungszentrum Informatik. Neben seiner Rolle als Betreiber des Testfelds nutzt der KVV das Testfeld, um neue Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs zu erproben – zum Beispiel autonom fahrende Mini-Busse für den On-Demand Personenverkehr.
Zum Reallabor

Deutsches Rettungsrobotik-Zentrum
Das Deutsche Rettungsrobotik-Zentrum (DRZ) ermöglicht den Brückenschlag zwischen Forschung und Praxis im Zivil- und Katastrophenschutz. Im Zentrum steht der Transfer robotischer Systeme in den realen Einsatz – mit dem Ziel, innovative Technologien im Hinblick auf die Bedarfe der Einsatzkräfte passgenau weiterzuentwickeln und zuverlässig in deren Alltag zu integrieren. Im Test- und Trainingszentrum des DRZ in Dortmund werden robotische Innovationen praxisnah erprobt und eingesetzt – von autonomen Erkundungsrobotern über Drohnen bis hin zu KI-gestützten Lagedarstellungen. In der Robotischen Task Force des DRZ können ausgereifte Demonstratoren und Prototypen in realitätsnahen Praxistestes und Einsätzen evaluiert werden. Ziel ist es, Einsatzkräfte in gefährlichen Situationen gezielt zu entlasten sowie ihre Sicherheit und Effektivität zu erhöhen. Als Schnittstelle zwischen Forschung, Industrie, Einsatzpraxis und Verwaltung schafft das DRZ eine Innovationsplattform, die nicht nur technologische Lösungen vorantreibt, sondern auch politische und organisatorische Rahmenbedingungen mitbetrachtet und aktiv mitgestaltet.
Zum Reallabor
Reallabor Bahn
Das Reallabor Bahn ist ein Projekt zur Forschung, Entwicklung und Erprobung von Innovationen im Bahnsystem, insbesondere im Bereich Digitalisierung und Automatisierung der Bahntechnologie. Dazu nutzt die DB die Strecke Annaberg - Schwarzenberg der Erzgebirgsbahn und rüstet diese mit weiteren Testanlagen für 5G Funktechnologie, Digitalen Stellwerken, ETCS und einem Erprobungsbahnhof für EULYNX / RCA aus. Darüber hinaus werden im Reallabor weitere innovative Anwendungen erprobt, darunter der Einsatz von Kompositmaterialien für Schwellen oder Lärmschutzwände sowie fahrzeugbasierte Sensorik und Vermessungen.
Zum Reallabor

Labor Autonome Baumaschinen
Das Baumaschinenlabor des Fraunhofer IOSB ist eine zentrale Infrastruktur für die Forschung und Entwicklung autonomer Systeme im Bereich schwerer Baumaschinen und Arbeitsmaschinen. Es besteht aus der ROBDEKON-Halle sowie einem weitläufigen Außengelände, das realitätsnahe Tests unter verschiedensten Einsatzbedingungen ermöglicht. Im Fokus stehen Technologien, die es Baggern, Unimogs, Radladern und ähnlichen Fahrzeugen erlauben, komplexe Aufgaben teil- oder vollautonom auszuführen. Hierfür werden die Maschinen mit moderner Sensorik – etwa Lidar, Kameras und GNSS – ausgerüstet und mit fortschrittlichen Algorithmen zur Umweltwahrnehmung, Situationsinterpretation und Handlungsplanung kombiniert. Das Labor gehört zur Forschungsgruppe "Autonome Robotersysteme" des Fraunhofer IOSB. Es werden dort innovative Autonomielösungen entwickelt, integriert und unter realen Bedingungen getestet und validiert. Dabei gehen Systementwicklung und praktische Erprobung Hand in Hand – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu robusten, praxistauglichen autonomen Baumaschinen. Das Labor dient sowohl der anwendungsnahen Forschung als auch der industrienahen Entwicklung und bietet ideale Voraussetzungen für Kooperationen mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand.
Zum Reallabor

Hansaponik
Im Reallabor Hansaponik, betrieben durch die Fachhochschule Südwestfalen und durch die Urbanisten e.V., werden innovative Nahrungsmittelproduktionssysteme wie Hydroponik, Aquaponik und Microgreens erforscht. Es wird dabei ein low-tech Ansatz mit gezielter Digitalisierung verfolgt, den die Betreiber als "clever-tech" beschreiben. Der Fokus liegt neben der technischen Machbarkeit oftmals auf der Entwicklung neuer, wirtschaftlich tragfähiger Geschäftsmodelle. Im Reallabor werden unter anderem hydroponische Anbauflächen an Nutzende aus der Nachbarschaft vermietet. Die Anlage auf dem ehemaligen Schwerindustriestandort Kokerei Hansa symbolisiert den Strukturwandel in der Region. Die Anlage wird neben Forschungsprojekten für die Ausbildung von Studierenden genutzt, die ihre Semester-, Bachelor- und Masterarbeiten über Themen rund um die Anlage schreiben können. Im Wintersemester 2024/2025 wurde auf einem der Beete im Rahmen einer Gruppenarbeit ein FarmBot installiert, der in Zukunft die Durchführung von Experimenten durch Automatisierung von Boniturvorgängen unterstützen soll. Das Reallabor wird 2027 Bestandteil der Internationalen Gartenausstellung sein.
Zum Reallabor

Marktfee.app / CrowdMyRegion - Spechbach
Das Projekt CrowdMyRegion zielte darauf ab, ein soziales Liefernetzwerk mit einem intelligenten, App-basierten Mitbringdienst zu etablieren. Durch die Marktfee.app konnten Nutzer Waren bei regionalen Geschäften online bestellen und entweder selbst abholen oder von anderen Community-Mitgliedern mitbringen lassen. So sollten Menschen, die zum Beispiel kein Auto haben oder aus gesundheitlichen Gründen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wieder besser an die Grundversorgung angeschlossen werden. Ein Algorithmus hat den Bedarf der Verbraucher prognostiziert und gezielt Personen informiert, die ohne großen Aufwand Einkaufs- und Lieferaufträge im Rahmen ihrer "Sowieso-Fahrten" übernehmen können. Im Ergebnis fördert dies die Bildung nachhaltiger Liefer-Communities, stärkt lokale Händler und verbessert die Nahversorgung im ländlichen Raum.
Zum Reallabor

Marktfee.app / CrowdMyRegion - Schönbrunn
Das Projekt CrowdMyRegion zielte darauf ab, ein soziales Liefernetzwerk mit einem intelligenten, App-basierten Mitbringdienst zu etablieren. Durch die Marktfee.app konnten Nutzer Waren bei regionalen Geschäften online bestellen und entweder selbst abholen oder von anderen Community-Mitgliedern mitbringen lassen. So sollten Menschen, die zum Beispiel kein Auto haben oder aus gesundheitlichen Gründen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wieder besser an die Grundversorgung angeschlossen werden. Ein Algorithmus hat den Bedarf der Verbraucher prognostiziert und gezielt Personen informiert, die ohne großen Aufwand Einkaufs- und Lieferaufträge im Rahmen ihrer "Sowieso-Fahrten" übernehmen können. Im Ergebnis fördert dies die Bildung nachhaltiger Liefer-Communities, stärkt lokale Händler und verbessert die Nahversorgung im ländlichen Raum.
Zum Reallabor

Reallabor Schorndorf
Busfahren nach Bedarf statt Fahrplan – das erprobte ein Team aus Wissenschaft und Praxis im Projekt „Reallabor Schorndorf“ gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in einer mittelgroßen Stadt nahe Stuttgart. Ziel war es, ein nachhaltiges und praxistaugliches Mobilitätskonzept zu entwickeln. Die Anforderungen der Nutzenden standen im Mittelpunkt der Entwicklung, um die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs zu erhöhen. Zwischen März und Dezember 2018 fuhren von Freitagnachmittag bis Sonntagnacht zwei Busse durch Schorndorf – auf Routen, die das digitale Bestellsystem per Algorithmus bedarfsgerecht aus den Fahrtwünschen der Nutzenden zusammenstellte. Diese konnten per Smartphone-App, Telefon, Computer oder über Einrichtungen wie Geschäfte und Cafés übermittelt werden. Durch die Einrichtung von mehr als 200 sogenannten virtuellen Haltepunkten als Ergänzung zu bestehenden Haltestellen verkürzten sich die Fußwege der Fahrgäste. Der Bedarfsbus ersetzte zwei bestehende Buslinien und fuhr nur, wenn er gebraucht wurde. So wurden Leerfahrten vermieden, Ressourcen gezielter eingesetzt und gleichzeitig ein Busverkehr mit hoher Verfügbarkeit angeboten. Von Anfang an wurden die Schorndorfer Bürgerinnen und Bürger eingebunden, beispielsweise mittels Informationsveranstaltungen, Befragungen, Workshops und als Testnutzende. Der Bedarfsbus wurde in einem offenen, lebendigen Prozess in Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Praxis entwickelt und getestet.
Zum Reallabor

Living Lab Energy Campus
Im Living Lab Energy Campus (LLEC) wird eine wissenschaftlich-technologische Plattform zur Entwicklung hoch integrierter Energieversorgungssysteme erprobt. Dies erfolgt durch lernfähige und vorausschauende Regelungsstrategien in den Bereichen Wärme, Strom, chemische Energiespeicher und Mobilität. Innerhalb des Projektverbundes werden dafür verschiedene Energie-Demonstratoren auf dem Campus installiert – wie flüssige und gasförmige Wasserstoff-Technologien, Lithium-Ionen-Batterien und Photovoltaik-Systeme – und über intelligente Steuerungsprogramme miteinander vernetzt. Ziel ist die Schaffung eines intelligenten Energiesystems, welches die Themen Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Benutzerkomfort gleichermaßen integriert. Der Reallabor-Charakter des Living Lab Energy Campus besteht vor allem darin, dass die im Sinne der Energieforschung genutzten wissenschaftlichen Demonstratoren in den laufenden Betrieb der Infrastruktur des Forschungszentrums integriert werden. So werden beispielsweise reguläre Bürogebäude und Schulungsräume mit Sensoren und Aktoren ausgestattet, um Energieverbräuche regelbasiert zu optimieren, während am Projekt nicht aktiv forschend beteiligte Mitarbeitende diese Räume nutzen. Gleichwohl können diese Mitarbeitenden über Nutzereinbindungstools direkt am Projekt teilnehmen, indem sie selbst energetische Parameter für ihr Büro festlegen und proaktiv verbessern.
Zum Reallabor

Energetische Nutzung von Grubenwasser in der Zinngrube Ehrenfriedersdorf
Das Grubenwasser in der Zinngrube Ehrenfriedersdorf bietet Potenzial als Wärme- und Kältequelle. Deswegen werden seit 2019 unterschiedliche Projekte am Standort durchgeführt. Schwerpunkte sind dabei neben der energetischen Nutzung des Wassers zur Beheizung des zum Bergwerk gehörenden Museumsgebäudes die saisonale Speicherung von Wärme und Kälte in Grubenwasser und die Steigerung der Systemeffizienz durch effektives Wärmeübertragerdesign. Durch im Grubenwasser mitgeführte Frachten (z. B. Bakterien und gelöste/ungelöste Metalle) bilden sich Ablagerungen im Wärmeübertrager zwischen Grubenwasser und Heizsystem. Diese Ablagerungen wirken wie eine Dämmung, wodurch weniger Energie als geplant entzogen werden kann. Durch eine an den Standort angepasste Materialauswahl können diese Ablagerungen reduziert werden. In mehreren Versuchen am Standort konnte bereits nachgewiesen werden, dass die Effizienz der Grubenwassergeothermie dadurch um bis zu 50 % verbessert werden kann.
Zum Reallabor

DelivAIRy bei Thyssen Steel
Im Reallabor haben die thyssenkrupp Steel AG und die doks. innovation GmbH den Transport von Material und Laborproben aus der Stahlerzeugung anhand automatisierter Drohnenflüge erprobt. Das Ziel bestand darin, den Materialtransport über automatisierte Drohnenflüge in den Regelbetrieb zu überführen. Im Rahmen des Reallabors wurde auf eine für die Erprobung modifizierte Drohne der Firma DJI zurückgegriffen. Dabei handelte es sich um einen Hexacopter (sechs Rotoren) mit einer Traglast von 6 kg und einer Maximalflugdauer von 25 min. Um die Drohne unter realen Bedingungen erproben zu können, waren zahlreiche Sicherheitsvorrichtungen integriert. Dazu zählten neben den ab Werk eingebauten redundanten Systemen (Rotoren, GPS-Antennen, Stabilisatoren) auch ein von der Bundesluftfahrtbehörde der USA für den Flug über Menschenmengen zertifizierter Fallschirm, der von den übrigen Systemen abgekoppelt ist und über eine autarke Energieversorgung verfügt. Die Drohnenflüge fanden über dem thyssen-Werksgelände in Duisburg ohne Operatoren im Sichtfeld statt; pro Flug wurde eine Distanz von 2 km Luftlinie zurückgelegt. Über eine Benutzeroberfläche konnten die Position der Drohne nachvollzogen und jederzeit sicherheitstechnische Eingriffe von außen (z. B. Notlandung, Auslösen des Fallschirms) ausgeführt werden.
Zum Reallabor

Smarte Demonstrationsfabrik Siegen (SDFS)
Die SDFS ist ein Reallabor für innovative Produktionstechnik im industriellen Maßstab. In diesem Rahmen werden die wesentlichen neue Technologien, wie Künstliche Intelligenz, 5G, digitale Zwillinge und smarte Fertigungssysteme unter realen Produktionsbedingungen erprobt, die für die Produktion der Zukunft von elementarer Bedeutung sind. Statt theoretischer Tests steht hier die praktische Anwendung zur Erforschung der Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie und der Entwicklung von Innovationen für das Produktionsmanagement im Vordergrund – in einer echten Fabrik mit realer Einzel- und Kleinserienfertigung. Die SDFS bietet Unternehmen und Forschungseinrichtungen eine Plattform, um Innovationen im laufenden Betrieb zu entwickeln, zu testen und zu übernehmen. Dabei entstehen praxisnahe Erkenntnisse darüber, wie neue Technologien in bestehende Fertigungs- sowie Unterstützungsprozesse integriert werden können – sei es im Schweißen, in der Montage oder in der Fertigungslogistik. Betrieben wird die SDFS projektbezogen und zeitlich befristet im Rahmen öffentlich geförderter Programme, mit Beteiligung von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. So entsteht mit dem Reallabor der SDFS ein lebendiges Umfeld für Innovation, Wissenstransfer und gemeinsames Lernen. Die Erfahrungen und entwickelten Innovationen aus der SDFS fließen nicht nur in die technologische Weiterentwicklung ein, sondern geben wichtige Impulse für neue regulatorische und organisatorische Ansätze in der Industrie.
Zum Reallabor

Pfaff-Quartier klimaneutral
Seit einigen Jahren entwickelt die Stadt Kaiserslautern das zentrumsnah gelegene Pfaff-Quartier zu einem klimaneutralen Mischgebiet. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände wurden 5 Gebäude saniert und das restliche Gelände erschlossen, das nun zur Neubebauung zur Verfügung steht. Die Quartiers-Entwicklung wird begleitet durch das Leuchtturmvorhaben EnStadt:Pfaff, das von BMWK und BMBF gefördert wurde. 8 Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie der Stadtverwaltung entwickeln und untersuchen Lösungen für klimaneutrale Quartiere. Fast 30 innovative Konzepte, Technologien und Komponenten für die Quartiersentwicklung aus den Bereichen Gebäude, Energie, Mobilität und Digitalisierung wurden entwickelt und teilweise im Gelände demonstriert. Darüber hinaus wurden Planungsprozesse untersucht. So wurden beispielsweise der Bebauungsplan und die innovativen Lösungen im aktiven Austausch mit den lokalen Akteuren entwickelt und erprobt. Aufgrund des langen Entwicklungszeitraums für das Quartier konzentriert sich das Reallabor auf die zentrale Pfaff-Achse. Die letzten Demonstratoren des Reallabors werden im Jahr 2025 fertiggestellt. Bis Ende 2027 schließt sich eine Transferphase an, in der die Erkenntnisse aus dem Reallabor interessierten Akteuren vermittelt werden.
Zum Reallabor

Klimaquartier Neue Weststadt
Im Mittelpunkt des Forschungsprojektes Klimaquartier Neue Weststadt steht das gleichnamige innovative Stadtquartier in Esslingen am Neckar. Mit dem Startschuss im November 2017 wird im Projekt erstmalig im urbanen Kontext in einem Stadtquartier grüner Wasserstoff erzeugt und lokal vermarktet. Einzigartig ist dabei die Abwärmenutzung eines Elektrolyse-Prozesses, für die Wärmeversorgung der Gebäude im Quartier. Das Leuchtturmprojekt zeigt auf, wie modernes Wohnen und Arbeiten sowie nachhaltige Mobilität im städtischen Kontext einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz beitragen kann. Bewohnerinnen und Bewohner und die Öffentlichkeit werden u. a. durch Befragungen und den Aufbau eines Informationszentrums in das Reallabor eingebunden. Das Informationszentrum befindet sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Esslingen, fungiert als "Eingangstor" in die Neue Weststadt und soll über interaktive Elemente den Zugang zu Themen der Nachhaltigkeit und Energieversorgung ermöglichen. Der Ergebnistransfer wird über wissenschaftliche Begleitforschung und den Aufbau einer zentralen Wissensplattform sichergestellt. Das Projekt wird durch die Förderinitiative "Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt", im Rahmen der Energieforschung der Bundesregierung durch das Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und das Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
Zum Reallabor

Testfeld Technologiepark Bremen
Im Testfeld Technologiepark Bremen werden Technologien des automatisierten und vernetzten Fahrens unter realen Bedingungen erforscht und getestet. Die Infrastruktur umfasst V2X-Kommunikation an mehreren Lichtsignalanlagen, 4G- und 5G-Vernetzung, RTK-Ortung sowie eine digitale HD-Karte im OpenDrive-Format. Erprobt werden unter anderem autonome Fahrmanöver wie selbstständiges Einparken, Engstellenassistenz und kooperative Fahrstrategien. Ziel ist die sichere, komfortable und umweltfreundliche Automatisierung des Stadtverkehrs. Mittlerweile zwei real ausgestattete Hybridfahrzeuge mit umfangreicher Sensorik (Kameras, Radar, Ultraschall, Lidar) sammeln Umgebungsdaten, die in Echtzeit verarbeitet und in virtuelle Modelle überführt werden. Die Erkenntnisse aus Projekten wie AO-Car, MUTIG-VORAN und dem Safety Control Center fließen in die Entwicklung von Fernsteuerungssystemen, Flottenmanagement und Smart-City-Integration ein.
Zum Reallabor

SmartFactoryOWL
Die SmartFactoryOWL ist eine offene und partizipative Industrie 4.0 Forschungs- und Demonstrationsfabrik auf dem Innovation Campus Lemgo. Technologien der Digitalisierung und KI in der Produktion werden in Zusammenarbeit mit der mittelständischen Industrie demonstriert und erforscht. Um die 5.000 Besucherinnen und Besucher jährlich aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft tauschen sich in der SmartFactoryOWL über Innovationen aus. Darüber hinaus bietet die SmartFactoryOWL innovativen Unternehmen ein geschütztes und herstellerneutrales Testfeld für eigene Produkt-, Prozess und Produktionsentwicklungen. Technologien rund um Nachhaltigkeit, humanzentrierte Automation sowie vernetzte Fabriken werden in der SmartFactoryOWL erforscht und getestet. Die als KI-Reallabor und energieoptimierte Smart-E-Factory bekannte Fabrik beherbergt auch eine reale Fertigung, an der 10 Partner kollaborativ forschen und produzieren. Auch in Technologieclustern wie it's OWL oder Centrum Industrial IT wird die SmartFactoryOWL als Plattform und Ökosystem zur kollaborativen und vorwettbewerblichen Entwicklung genutzt.
Zum Reallabor

e-Maritime Integrated Reference Platform eMIR
eMIR ist eine Technologieentwicklungs- und -erprobungsplattform für hochautomatisierte und autonome maritime Systeme. eMIR besteht dabei aus einem virtuellen und physischen Teil. Der virtuelle Teil enthält Schiffsführungssimulatoren sowie eine maritime Verkehrssimulation, mit der verschiedene Verkehrslagen simuliert werden können. Der physische Teil besteht aus Sensorik zur Verkehrsüberwachung, mobilen Leitständen, VTS-Systemen und zwei hochautomatisierten Forschungsbooten, die u. a. ferngesteuert werden können, sowie einem Teststand für Fernsteuerung. Wesentliches Kernelement ist eine Testfeldarchitektur, die etablierte Standards nutzt und so Interoperabilität ermöglicht. eMIR erstreckt sich über die deutsche Bucht, die Außenelbe bis Brunsbüttel und die Seehäfen Cuxhaven, Wilhelmshaven und Emden.
Zum Reallabor

GreenTEC Campus
Der GreenTEC Campus in Enge-Sande ist ein Reallabor für nachhaltige Mobilität und erneuerbare Energien im ländlichen Raum. Auf dem 130 Hektar großen Gelände einer ehemaligen Kaserne werden verschiedene Formen der dezentralen Energieerzeugung und -speicherung unter realen Bedingungen erprobt – zum Beispiel durch Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und netzunabhängige Systeme –, die unter anderem für E-Mobilitätslösungen und Ladeinfrastruktur zum Einsatz kommen können. Der Fokus liegt auf praxisnaher Anwendung, nicht auf theoretischer Entwicklung. Gesucht werden gezielt Start-ups und Unternehmen, die sich am Standort ansiedeln und Synergieeffekte mit anderen Akteuren nutzen wollen. Voraussetzung ist eine technologische, grüne und zukunftsorientierte Ausrichtung, passend zum entstehenden Technologiecluster. Der Campus bietet neben Infrastruktur auch Vernetzung, Sichtbarkeit und Raum für Kooperation. Ziel ist es, Innovationen nicht nur zu testen, sondern in die Anwendung zu bringen – regional, skalierbar und gesellschaftlich wirksam. Der GreenTEC Campus versteht sich als Test & Proving Ground, der sowohl Unternehmen, Vereinen, Politikerinnen und Politikern sowie Schulklassen und Fachkräften, aber auch Privatpersonen Innovationen im Zusammenhang mit der Energiewende näherbringt.
Zum Reallabor

Aldenhoven Testing Center
Das Aldenhoven Testing Center ist ein modernes, interdisziplinäres Testzentrum für Mobilität. Zwölf Streckenelemente erlauben es, annähernd alle Situationen aus dem Realverkehr nachzubilden. Die Kundinnen und Kunden des Aldenhoven Testing Centers können für ihre Tests unter anderem auf ein 2 km langes Oval mit Steilkurven, eine Fahrdynamikfläche mit 210 m Durchmesser, einen Hügel mit Steigungen bis 30 % sowie ein vierspuriges Autobahnelement nutzen. Seit 2016 ergänzt ein Kreuzungsbereich das Angebot, der 2018 zu einer vollwertigen städtischen Testumgebung ausgebaut wurde. Auch eine Bremsenstrecke, ein Handlingkurs sowie eine Schlechtwegstrecke können genutzt werden. Mit der Abdeckung durch Europas modernstes Mobilfunk-Testfeld und weiteren Funkstandards kann die Vernetzung der Fahrzeuge im Verkehr (V2X) allumfassend dargestellt werden. Dank einer Kooperation mit Vodafone verfügt das Gelände über ein offenes Mobilfunk-Testfeld, das 5G Mobility Lab. Das Aldenhoven Testing Center ist ein Joint Venture des Kreises Düren und der RWTH Aachen, das allen interessierten Unternehmen, insbesondere KMU und Start-ups, gleichermaßen offensteht. Zu den Kunden gehören Fahrzeughersteller und -zulieferer, Forschungs- und Entwicklungsdienstleister sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Darüber hinaus ist es eine beliebte Location für Firmenevents.
Zum Reallabor

Maritime Explorationshalle am DFKI in Bremen
Die rund 1.300 m² große Maritime Explorationshalle dient dem Test und der Entwicklung neuer Robotertechnologien für den Einsatz auf und unter Wasser. Konkrete Missionsszenarien aus dem Alltag der Offshore-Industrie können nachgestellt, Manöver gefahren und die Fähigkeiten zukünftiger Systeme entwickelt, getestet und demonstriert werden. Darüber hinaus lassen sich Systeme für die Weltraumrobotik in simulierter Schwerelosigkeit testen. Die Infrastruktur der Halle besteht aus einem Salzwasserbecken, zwei kleineren separaten Testbassins, einem Virtual-Reality-Labor, einer Druckkammer sowie einer vollständigen technischen Einrichtung, die von Kränen bis zu weiteren Arbeitslaboren reicht. Das Kernstück der Testanlage ist das 23 Meter lange, 19 Meter breite und 8 Meter tiefe Becken. Mit 3,4 Millionen Litern Salzwasser schafft es Forschungsbedingungen, die unabhängig von der Witterung sind, sich kontrollieren und beobachten lassen und zudem realitätsnahe Bedingungen für den Robotereinsatz bieten.
Zum Reallabor

Multifunktionshalle mit künstlicher Mondkraterlandschaft und flexibler Experimentierfläche (DFKI Bremen)
Die rund 550 m² große Multifunktionshalle dient dem Aufbau und der Durchführung robotischer Experimente. Dank einer Deckenhöhe von über 10 m sind auch Erprobungen mit flugfähigen Systemen möglich. Ein Portalkran mit einer Nutzlast von bis zu 12,5 t erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich. Die Experimentierfelder können über Bodenschächte mit 230 V, Drehstrom, Netzwerkanschluss und Druckluft versorgt werden, sodass eine große Bandbreite unterschiedlicher Versuchsaufbauten realisiert werden kann. Ein zentrales Element der Halle ist die künstliche Mondkraterlandschaft, die auf Daten realer Südpolkrater sowie auf Bildmaterial der Apollo-Missionen basiert. Sie ermöglicht die Erprobung frei kletternder robotischer Systeme und die anschauliche Demonstration ihrer Mobilität. Die Tragfähigkeit ist für große Systeme ausgelegt, sodass verschiedenste Lokomotionskonzepte getestet werden können. Auf der Experimentierfläche befinden sich derzeit zwei längerfristige Installationen: die Testanlage Lokomotion sowie der MRK-Aufbau (Mensch-Roboter-Kollaboration). Die Testanlage besteht aus einer variablen Rampe mit Steigungen von 0° bis 45° in 5°-Schritten – wahlweise in Längs- oder Querrichtung. Derzeit ist zudem ein Laufband integriert, das kontinuierliche Messungen und Anpassungen des robotischen Laufverhaltens ermöglicht. Im MRK-Bereich werden Fragen der physischen Mensch-Roboter-Interaktion und -Kollaboration erforscht sowie verschiedene MRK-fähige Systeme evaluiert und demonstriert.
Zum Reallabor
Roof Water-Farm
Im Reallabor Roof Water-Farm wird Abwasseraufbereitungstechnologie mit Nahrungsmittelproduktion verknüpft. Dabei kommen Hydroponik und Aquaponik als gebäudeintegrierbare, wasserbasierte Farmingstrategien zum Einsatz. Im innerstädtischen Reallabor wird aktiv Klimaschutz durch Regenwassermanagement im und am Gebäude umgesetzt, es werden Pflanzen zur Verdunstung und CO2- Speicherung eingesetzt. Mit der breiten Umsetzung der hier entwickelten Technologien und Konzepte können Häuser und Quartiere in Zukunft anstelle von Abwasser hochwertiges Betriebswasser und frische Nahrungsmittel produzieren und somit einen Baustein zum zirkulären Wirtschaften liefern. Die hierfür notwendigen Technologien können vor Ort in der Demonstrationsanlage im Quartier "Block 6", einem Wohnbau-Projekt der Internationalen Bauausstellung von 1987 mit innovativem Wasserkonzept in Berlin-Kreuzberg, besichtigt werden.
Zum Reallabor

:metabolon - Von der Deponie zum Innovationsstandort
Im Reallabor :metabolon geht es um die Entwicklung innovativer Konzepte in den Bereichen Ressourceneffizienz, Abfallvermeidung und zirkuläre Wertschöpfung. Seit 2011 hat sich die Leppe-Deponie zu einem Zentrum für Umweltbildung und -forschung entwickelt, mit dem Ziel, von einem linearen zu einem zirkulären Wirtschaftssystem zu wechseln. Erprobt werden insbesondere Innovationen zur Nutzung von Roh- und Reststoffen sowie zirkulären Produktionsansätzen. Dabei wird untersucht, wie Abfälle in Sekundärrohstoffe umgewandelt und in industrielle Prozesse integriert werden können. Zudem werden neue Technologien und Geschäftsmodelle entwickelt, die eine ressourcenschonende Wirtschaft fördern. Dazu zählen etwa die nachhaltige Aufbereitung von Sekundärrohstoffen aus Reststoffen und deren kaskadenförmige stoffliche und energetische Verwertung sowie abfallwirtschaftliche Prozesse und Behandlungsverfahren unter Einsatz von Brauchwasser. Ein wichtiger Aspekt des Reallabors ist die enge Zusammenarbeit mit Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen und Bildungseinrichtungen. Diese Vernetzung ermöglicht den Wissenstransfer und die Umsetzung der Innovationen in die Praxis. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen helfen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern und zirkuläres Denken in der breiten Bevölkerung zu verankern.
Zum Reallabor

Forschungskreuzung Aschaffenburg
Die Forschungskreuzung an der hochfrequentierten Hauptverkehrsstraße Würzburger Straße (Ecke Flachstraße und Spessartstraße) in unmittelbarer Nähe zum Campus 1 der TH Aschaffenburg ist mit Kamerasystemen, LiDAR-Radar-Sensoren und einer Wetterstation ausgestattet. Sie ermöglicht eine lückenlose Erfassung von Verkehrsfluss, Fußgängerbewegungen und Radverkehr. Die Daten bilden die Grundlage für Forschungsprojekte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie zur Weiterentwicklung von autonomen Fahrfunktionen und intelligenter Infrastruktur. An der Kreuzung werden Projekte durchgeführt, die sich z. B. mit der Verhaltensmodellierung von Fußgängerinnen, Fußgängern und Radfahrenden sowie der Kooperation zwischen Fahrzeugen, Verkehrsteilnehmenden und Infrastruktur befassen. Zudem verfügt die Kreuzung über ein hochgenaues digitales Modell (~1 cm Genauigkeit). Auf dieser Basis können synthetische Verkehrsdaten erzeugt werden, die für vielfältige Anwendungen genutzt werden. Dadurch entsteht ein großer Datensatz, der auch kritische und seltene Szenarien umfasst, die in der Realität nur selten beobachtet werden oder aus ethischen Gründen nicht nachgestellt werden dürfen (z. B. Beinahe-Kollisionen). Diese synthetischen Daten ergänzen die realen Messdaten und ermöglichen eine robuste Entwicklung und Validierung von Algorithmen für automatisiertes und kooperatives Fahren. Alle Aufnahmen und Modelle dienen ausschließlich Forschungszwecken.
Zum Reallabor
Karte für Reallabore aus Nordrhein-Westfalen: Digi-Sandbox.NRW
Mit der Digi-Sandbox.NRW bietet das Land Nordrhein-Westfalen eine zentrale Anlaufstelle, um über Reallabore in NRW zu informieren und innovative Akteure bei der Umsetzung von Reallaboren zu unterstützen. Sofern Ihr Reallabor in NRW angesiedelt ist, können Sie es zusätzlich auch auf der Karte der Digi-Sandbox eintragen. Zur Digi-Sandbox.NRW
